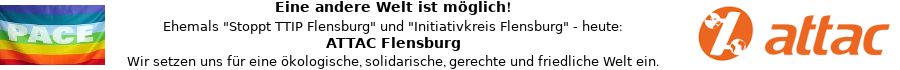Kampagne gegen die geplante Stationierung von Angriffswaffen in Deutschland formiert sich
von: Jürgen Wagner | Veröffentlicht am: 7. Januar 2025 - IMI-Standpunkt 2025/001
Immer wenn im Westen von Fähigkeits- oder Raketenlücken gesprochen wird, ist allergrößte Vorsicht geboten. Nur allzu oft stellten sich Behauptungen über die Hochrüstung erklärter Gegner als glatte Lüge oder zumindest als grobe Übertreibungen heraus, um die eigenen Rüstungsbestrebungen zusätzlich zu befeuern. So auch im jüngsten Fall, der geplanten Stationierung von US-Mittelstreckwaffen in Deutschland, deren katastrophalen Folgen sich schon jetzt immer deutlicher abzeichnen. Umso wichtiger ist es, dass sich allmählich unter anderem mit der Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig!“, an der sich auch die Informationsstelle Militarisierung (IMI) beteiligt, auch der Widerstand dagegen formiert.
Fähigkeitslücke…
Auffällig ist zunächst, wie dünn die gerade einmal vier läppischen Sätze daherkommen, mit denen eine deutsch-amerikanische Erklärung vom 10. Juli 2024 das Vorhaben angekündigte, ab 2026 diverse US-Mittelstreckensysteme hierzulande für die „Abschreckung“ zu stationieren: „Die Vereinigten Staaten von Amerika werden, beginnend 2026, als Teil der Planung zu deren künftiger dauerhafter Stationierung, zeitweilig weitreichende Waffensysteme ihrer Multi-Domain Task Force in Deutschland stationieren. Diese konventionellen Einheiten werden bei voller Entwicklung SM-6, Tomahawks und derzeit in Entwicklung befindliche hypersonische Waffen umfassen. Diese werden über deutlich größere Reichweite als die derzeitigen landgestützten Systeme in Europa verfügen. Die Beübung dieser fortgeschrittenen Fähigkeiten verdeutlichen die Verpflichtung der Vereinigten Staaten von Amerika zur NATO sowie ihren Beitrag zur integrierten europäischen Abschreckung“ (Gemeinsame Erklärung der Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland zur Stationierung weitreichender Waffensysteme in Deutschland)
Eine nicht viel ausführlichere Begründung lieferte Verteidigungsminister Boris Pistorius nahezu parallel dazu mit folgenden Worten ab: „Wir reden hier über eine durchaus ernst zu nehmende Fähigkeitslücke in Europa.„
Fast zehn Tage später schoben dann die die Parlamentarischen Staatssekretäre Siemtje Möller (Verteidigung) und Tobias Lindner (Auswärtiges Amt) in einem Schreiben an den Außen- und Verteidigungsausschuss des Bundestages eine etwas ausführlichere Begründung nach: „Russland hat in den vergangenen Jahren massiv im Bereich weitreichender Raketen und Marschflugkörper aufgerüstet. […] Wir beobachten, dass Art und Umfang der massiven russischen Aufrüstung auch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hinaus zur Aufstellung und Stärkung von gegen den Westen gerichteten Fähigkeiten und Kapazitäten genutzt werden.“ (Siemtje Möller/Tobias Lindner, Spiegel Online, 19.7.2024)
Viel kam danach nicht mehr, im Wesentlichen ist es bei dieser knappen Argumentation geblieben, die viele Expert*innen aus guten Gründen für wenig überzeugend halten. Die wohl lauteste kritische Stimme ist Oberst a.D. Wolfgang Richter, der als früherer Abteilungsleiter beim Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr wissen dürfte, von was er da spricht. Zuerst in einer ausführlichen Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung und später in einem Buchbeitrag für den von Johannes Varwick herausgegebenen Sammelband „Die Debatte um US-Mittelstrecken in Deutschland“ kam er zu der Schlussfolgerung: „Die Behauptung einer so genannten Fähigkeitslücke als Begründung für eine Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen ist nicht nachvollziehbar.“ (Wolfgang Richter, Oberst a.D.)
Stationierungsbefürworter wie der Wissenschaftler Jonas Schneider und Bundeswehr-Oberst Torben Arnold begründen in einem Papier für die regierungsberatende „Stiftung Wissenschaft und Politik“ ihre Position folgendermaßen: „Moskau verfügt über den Marschflugkörper SSC-8 (Zahl im hohen zweistelligen Bereich), der den INF-Vertrag 2019 zu Fall brachte, seit 2023 über die Raketen Zolfaghar aus Iran (rund 400 Stück) und KN-23 aus Nordkorea (etwa 50 Stück). Die seegestützten Hyperschall-Marschflugkörper Zirkon (Zahl im hohen zweistelligen Bereich) verschießt Russland seit 2024 auch von Land aus. Von seiner ballistischen Iskander-Version SS-26 müsste Moskau trotz ihres Einsatzes gegen die Ukraine noch deutlich über 100 Stück haben (Fachleute betrachten die SS-26 als Mittelstreckenwaffe.) Die Bilanz: Russland besitzt weit über 500 bodengestützte Mittelstreckenflugkörper, die Nato in Europa bislang keinen einzigen.“ (Jonas Schneider/Torben Arnold, SWP-Aktuell, Nr. 36/2024)
Selbst wenn man diese – womöglich deutlich zu hoch gegriffene – Zahl für bare Münze nehmen sollte, wird allerdings noch lange kein Rüstungsschuh daraus. Wolfgang Richter und andere weisen darauf hin, dass Russland zwar tatsächlich über deutlich mehr landgestützte Kurz- und womöglich auch Mittelstreckenwaffen verfügt als die NATO, dies aber durch deren Überlegenheit bei see- und luftgestützten Waffensystemen mehr als wettgemacht werde. So etwa auch Ulrich Kühn vom Forschungsbereich „Rüstungskontrolle und Neue Technologien“ am „Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik“ Hamburg: „Es stimmt, dass Europa bisher nicht über bodengestützte Abstandswaffen in diesem Spektrum verfügt. Allerdings verfügen Nato-Staaten über luft- und seegestützte Mittelstreckenraketen, weshalb keine generelle Fähigkeitslücke besteht.“ (Ulrich Kühn, ISFH, Neues Deutschland, 30.8.2024)
Konkret spricht Wolfgang Richter in seinem Buchbeitrag davon, „mehr als 3.000 solcher Wirkmittel“ befänden sich in Europa im Bestand von NATO-Staaten (die gesamten westlichen Arsenale liegen noch einmal deutlich höher).
… oder Angriffswaffen
Von einer russischen Überlegenheit kann also keine Rede sein, eine Fähigkeitslücke existiert nicht, es sei denn, man will unbedingt die speziellen Eigenschaften landgestützter Waffensysteme nutzen. See- und luftgestützte Waffen brauchen länger um ihr Ziel zu erreichen, es bleibt Zeit für die Lagefeststellung und für einen etwaigen Gegenschlag, sie sind damit per se nur bedingt offensiv für Überraschungsangriffe auf strategische Ziele (Radaranlagen. Raketensilos, Kommandozentralen…) geeignet – ganz im Gegenteil zu den ultraschnellen und hochmobilen landgestützten Systemen, die nun in Deutschland stationiert werden sollen. Wie Wolfgang Richter in seinem Buchbeitrag kritisiert, lassen die Pläne kaum einen anderen Schluss zu: „Dafür gibt es jedoch nur ein operativ logisches Szenario: Die NATO schießt zuerst.“
Und genau in dieser Kritik erblicken Stationierungsbefürworter wie die bereits zitierten Jonas Schneider und Torben Arnold den „Wert“ dieser Waffen: „Marschflugkörper, die von Flugzeugen abgefeuert werden, müssen zuerst in die Luft gebracht werden, wodurch wertvolle Zeit verlorengeht. […] Verfügbare seegestützte Marschflugkörper haben entweder zu kurze Reichweiten oder sind wegen ihrer eher geringen Geschwindigkeit zu lange unterwegs für zeitkritische Ziele im russischen Kernland. […] Nicht nur die LRHW, auch die SM 6-Version der Army fliegen mit über fünffacher Schallgeschwindigkeit und sind im Zielanflug manövrierbar. Daher sind sie hocheffektiv gegen mobile Ziele und sehr schwer abzufangen, selbst für moderne Raketenabwehr. Die Dark Eagle ist mit bis zu 17-facher Schallgeschwindigkeit kaum zu stoppen. Mit dieser hohen Eindringfähigkeit sind beide Waffen ideal, um auch solche russischen Hochwertziele auszuschalten, die gezielt geschützt werden.“ (Jonas Schneider/Torben Arnold, SWP-Aktuell, Nr. 36/2024)
Noch deutlicher wurde ihre Kollegin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Claudia Major, die in einem viel zitierten Beitrag bereits im Sommer 2024 folgende Sätze zum Besten gab: „Die Tomahawks sollen bis zu 2500 Kilometer weit fliegen können, könnten also Ziele in Russland treffen. Und ja, genau darum geht es. […] So hart es klingt. Im Ernstfall müssen NATO-Staaten auch selbst angreifen können, zum Beispiel, um russische Raketenfähigkeiten zu vernichten, bevor diese NATO-Gebiet angreifen können, und um russische Militärziele zu zerstören, wie Kommandozentralen.“ (Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik, Handelsblatt, 19.07.2024)
Risiken und Nebenwirkungen
Die katastrophalen Folgen der Stationierungspläne sind schon heute offensichtlich. All das wäre unmöglich gewesen, hätten die USA nicht im Februar 2019 unter zumindest zweifelhaften Anschuldigungen, den INF-Vertrag gekündigt, der u.a. Produktion, Besitz und Stationierung landgestützter Kurz- und Mittelstreckenaffen mit Reichweiten zwischen 500km und 5.500km verbot. Auch der anschließende russische Vorschlag für ein beiderseitiges Moratorium wurde abgelehnt und umgehend schon lange ausgearbeitete US-Pläne zur Entwicklung neuer Waffensysteme aus der Schublade geholt.
Dennoch hielt sich Russland aus seiner Sicht lange an das Moratorium: Im Prinzip hatte sich dieses Moratorium aber mit dem mit einer russischen Mittelstreckenrakete („Oreshnik“) am 21. November 2024 erfolgten Angriff auf Ziele in der Ukraine erledigt – auch wenn Russland die Angriffe zynisch noch als „Live-Test“ bezeichnete. Gleichzeitig wurde die umfassende Produktion und gegebenenfalls Stationierung dieser und anderer Mittelstreckenwaffen angekündigt, sollte der Westen nicht von seinen Plänen abrücken: „Wir entwickeln Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen als Antwort auf die Pläne der Vereinigten Staaten, Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu produzieren und zu stationieren. […] Ich möchte Sie daran erinnern, dass Russland sich freiwillig und einseitig verpflichtet hat, keine Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen zu stationieren, solange amerikanische Waffen dieser Art in keiner Region der Welt auftauchen. […] Die Frage der weiteren Stationierung von Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite wird von uns in Abhängigkeit von den Aktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten entschieden werden.“ (Wladimir Putin, 21.11.2024)
Vor wenigen Tagen wurde das Moratorium dann durch den russischen Außenminister Sergej Lawrow auch offiziell faktisch aufgekündigt: „Heute ist klar, dass zum Beispiel unser Moratorium für die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen praktisch nicht mehr umsetzbar ist und aufgegeben werden muss. Die USA haben die Warnungen Russlands und Chinas arrogant ignoriert und sind in der Praxis dazu übergegangen, Waffen dieser Klasse in verschiedenen Regionen der Welt zu stationieren.“ (Sergej Lawrow, Die Welt, 30.12.2024)
So gefährlich diese Entwicklung ist, überraschen kann sie nicht und Experten wie Wolfgang Richter haben schon unmittelbar nach der deutsch-amerikanischen Ankündigung ihrer Stationierungsabsichten genau davor gewarnt: „Im Unterschied zum Doppelbeschluss von 1979 enthält die bilaterale Stationierungsentscheidung keinen Ansatz für eine rüstungskontrollpolitische Einhegung der Eskalationsgefahren und des nun wahrscheinlichen Stationierungswettlaufs mit Russland. Das russische Angebot eines Moratoriums für die Stationierung von landgestützten Langstreckenwaffen im INF-Spektrum dürfte sich damit erledigt haben, zumal Moskau bereits Gegenmaßnahmen angekündigt hat.“ (Wolfgang Richer)
Genauso wurde früh davor gewarnt, Russland werde sich gezwungen sehen, etwaige Pläne zur Stationierung landgestützter Mittelstreckenwaffen mit einer Absenkung seiner nuklearen Einsatzschwelle zu kontern – und auch dies ist mit der neuen russischen Nukleardoktrin geschehen, die am 19. November 2024 in Kraft gesetzt wurde: „Diese Veränderung läuft auf eine erhebliche Absenkung der Schwelle für einen atomaren Ersteinsatz in einem bis dahin konventionellen Krieg und damit auf eine Erhöhung des Risikos einer unkontrollierbaren atomaren Eskalation hinaus.“ (Rainer Böhme und Wolfgang Schwarz, Das Blättchen, 2.12.2024)
Im Februar 2026 läuft außerdem der letzte große russisch-amerikanische Rüstungskontrollvertrag („New Start“) aus. Er verpflichtet beide Seiten Obergrenzen der strategischen Waffen mit interkontinentaler Reichweite einzuhalten, sowohl was die nuklearen Sprengköpfe (1.550) als auch die Trägersysteme (800) anbelangt. Bleibt es bei der Stationierungsentscheidung dürften die ohnehin geringen Aussichten auf eine Verlängerung gegen null sinken. Die Kontrahenten haben aktuell zusätzlich noch tausende Sprengköpfe eingelagert, die binnen Monaten montiert werden könnten. Auch mit der Produktion neuer Sprengköpfe wäre zu rechnen – und ebenso damit, dass dann andere Atomwaffenstaaten ihre Arsenale ebenfalls noch weiter ausbauen würden.
Kampagne formiert sich
Allein diese unvollständige Aufzählung einiger der katastrophalen Auswirkungen der Stationierungspläne sollte als Motivation ausreichen, sich gegen diese Waffensysteme zu engagieren.
Am 3. Oktober 2024 wurde hierfür der Berliner Appell „Gegen neue Mittelstreckenwaffen und für eine friedliche Welt“ bei der Friedensdemonstration in Berlin gestartet. Er wurde bislang von über 26.500 Menschen unterzeichnet, was hier möglich ist. Im November 2024 wurde darüber hinaus die Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig!“ ins Leben gerufen, der sich mittlerweile über 40 zivilgesellschaftlichen Gruppen angeschlossen haben: „Ziel der Kampagne ‚Friedensfähig statt erstschlagfähig: Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen!‘ ist es, möglichst breite und bundesweite Proteste gegen die geplante Stationierung landgestützter US-Marschflugkörper, Hyperschallwaffen und Raketen in Deutschland zu bündeln. Wir wollen über die Risiken und Gefahren der Stationierung aufklären und so die dringend nötige Debatte lostreten, vor der sich der Bundeskanzler seit der Ankündigung der Stationierung im Juli 2024 drückt.“
Damit dies gelingt und die Kampagne Fahrt aufnimmt, werden auch weitere Gruppen gesucht, die sich ihr anschließen. Eine Mehrheit der Bevölkerung spricht sich jetzt schon gegen die Stationierungspläne aus, es besteht also durchaus die Aussicht, zahlreiche Menschen hinter den Forderungen zu versammeln, die sich auf der Internetseite der Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig!“ finden lassen:
— Stopp der geplanten Stationierung neuer US-Mittelstreckensysteme in Deutschland
— Abbruch der Projekte zur Entwicklung eigener europäischer Hyperschallwaffen und Marschflugkörper, an denen Deutschland sich beteiligen will
— Neue Initiativen für gemeinsame Sicherheit und Zusammenarbeit und die langfristige Vision einer neuen Friedensordnung in Europa
— Dialog statt Aufrüstung: Wiederaufnahme von Verhandlungen über Rüstungskontrolle und (nukleare) Abrüstung (z.B. für ein multilaterales Folgeabkommen zum INF-Vertrag)
Vorabdruck. Kabinett des Grauens. Am 20. Januar tritt Donald Trump seine zweite Amtszeit als Präsident an. Ein Überblick über die neue US-Regierung
In der kommenden Woche erscheint im Hamburger VSA-Verlag die Flugschrift »Trumps Triumph?«. Ingar Solty behandelt darin die Frage der kommenden Politik im Weißen Haus. Wir drucken mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag vorab einen redigierten Auszug. (jW)
Nach dem Wahlsieg fiel vor allem eins auf: wieviel besser das Trump-Lager diesmal vorbereitet war. Man vollzog die Verkündung der Personalentscheidungen mit einiger Cleverness. Trump hatte nicht bloß die Stimmen der multiethnischen Arbeiterklasse zu signifikanten Teilen gewonnen, sondern auch gelernt, die abgestandene Sprache der (links-)liberalen Identitätspolitik gegen seinen am Boden liegenden Gegner zu wenden. Genüsslich imitierte er bei der Ernennung von Susie Wiles die Rhetorik der »firsts« – »first black president«, »first woman«, »first openly gay«. Die 67 Jahre alte Managerin der Kampagne, zudem Lobbyistin für zuletzt 42 Konzerne, wird als Stabschefin im Weißen Haus tätig sein: »Susie« werde die »erste Frau in der Geschichte der Vereinigten Staaten, die das Amt bekleiden wird«. Eine Kooptation der Sprache seines Gegners, die das ganze Elend des progressiven Neoliberalismus bloßlegt, der den Fortschritt nicht anhand materieller Verbesserungen misst, sondern anhand symbolischer Repräsentation.
Entsprechend schwer tat sich die linksliberale Blase auch damit, dass Trumps designierter Finanzminister Scott Bessent nicht nur ein marktradikaler Milliardär, sondern der erste offen homosexuelle Mann in diesem Amt sein wird. Bessent sei »seine Community offenbar egal«, echauffierte sich das Portal LGBTQNation über dessen Bereitschaft, »für die LGBTQ+-feindlichste Regierung aller Zeiten zu arbeiten«. Der Gedanke, dass Bessent womöglich einer anderen, sehr viel entscheidenderen Community angehört, nämlich der Gemeinschaft der Milliardäre, lag offensichtlich fern. Was die betrifft, wird er in guter Gesellschaft sein. Mindestens 13 Milliardäre rücken am 20. Januar in höchste Regierungsämter.
Loyalität oder Ideologie?
Einer der Strippenzieher bei der Kabinettsbildung war Howard Lutnick, ein Milliardär und alter Freund Trumps. Mit Blick auf die erste Trump-Regierung sprach Lutnick von »Anfängerfehlern«, die es nun zu vermeiden gelte. In den Medien wurde viel über die Personalie Robert F. Kennedy Jr. gesprochen, der als Coronaskeptiker neuer Gesundheitsminister werden soll. Die Aufregung verdeckte eine wichtigere Frage: die nach dem Motiv der Akquise. War uneingeschränkte Loyalität zu Trump das entscheidende Kriterium oder ideologische Reinheit? Tatsächlich hat Trump viele Gefolgsleute um sich geschart, die sich als treue Weggefährten erwiesen haben. Zu ihnen gehören die designierten Chefs Lee Zeldin (Umweltschutzbehörde), Russell Vought (Bundeshaushaltsbehörde), John Ratcliffe (CIA) und Brooke Rollins (Landwirtschaftsministerium) sowie die designierte Generalstaatsanwältin Pam Bondi und Elise Stefanik, designierte UN-Botschafterin der USA.
Bondi stammt aus der Tea-Party-Bewegung und ist regelmäßig bei Fox News zu Gast. Als Generalstaatsanwältin in Florida stellte sie ein Betrugsverfahren gegen Trump ein, den sie später als Anwältin vertrat. Zeldin wiederum hat Trump schon während des ersten Amtsenthebungsverfahrens vom Dezember 2019 vertreten. Als republikanischer Abgeordneter hatte er sich vor allem für die Verschärfung des Abtreibungsrechts sowie für eine proisraelische Politik eingesetzt, jetzt soll er die Umweltschutzbehörde übernehmen, und das heißt: sie systematisch schrumpfen und entmachten.
Die entscheidende Personalie unter den Trump-Loyalen ist Vought. Der antikommunistische Kulturkrieger erwarb sich in der ersten Trump-Regierung als Chef des »Office of Management and Budget« Loyalitätspunkte, indem er der von Trump nicht anerkannten Biden-Regierung den Zugang zur ständigen Verwaltung versperrte. Jetzt soll er auf seinen Posten zurückkehren. Dort dürfte der nach eigener Aussage »christliche Nationalist« den Kulturkampf in den Bundeshaushalt tragen. Im Februar 2018 sprach er im Senat davon, dass »Muslime nicht bloß theologisch defizitär«, sondern als »Ungläubige«, die Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennen würden, auch »verdammt« seien. Nach seinem Ausscheiden gründete er das »Center for Renewing America«, das sich dem Kampf gegen die »Critical Race Theory« verschrieben hat, und war eine zentrale Figur beim »Project 2025«.
Wall Street vs. Industrie
Für die Hegemoniefähigkeit des Trump-Projekts ist die wirtschaftspolitische Ausrichtung entscheidend. Seit der neoliberalen Wende wird darüber im Finanzministerium entschieden, bei Scott Bessent also. Die ersten Schritte zu seinem Milliardenvermögen machte er als Mitarbeiter von George Soros. So war Bessent an der berüchtigten Spekulation beteiligt, die auf einen herbeigeführten Kursverfall des britischen Pfunds wettete. Der Gewinn betrug eine Milliarde US-Dollar. Bessent war auch mit an Bord, als das Finanzunternehmen eine ähnliche Operation gegen den japanischen Yen unternahm. Seine Anteile an der Beute nutzte er für die Gründung eines eigenen Hedgefonds, der »Key Square Group«, die nicht nur engen Kontakt zu Soros hielt, sondern wie dieser auf die Demokraten setzte. So trat Bessent als finanzieller Unterstützer von Al Gore, Hilary Clinton und Barack Obama in Erscheinung, ehe er 2016 die Trump-Kampagne mit Beträgen im hohen zweistelligen Millionenbereich finanzierte.
Als Repräsentant des Finanzkapitals sorgt sich Bessent vor allem um die Profite der Wall Street. Mit seiner Person könnte, wie schon 2016, die Perspektive einer dauerhaften Einhegung Trumps durch das globale Finanzkapital verbunden sein. Seine wirtschaftspolitische Ausrichtung ist entsprechend eher neoliberal und marktradikal: Senkung von Steuern für Konzerne und Superreiche durch Haushaltsdisziplin (soziale Kürzungsmaßnahmen und Austerität), expansive Geldpolitik und Offenheit für Industriesubventionen vor dem Hintergrund der Konkurrenz mit China. Handelspolitisch hingegen warnt Bessent im Interesse des Finanzkapitals, das auf global uneingeschränkte Mobilität angewiesen ist, vor dauerhaftem Protektionismus durch Außenhandelszölle, da sie die Börsenkurse beeinträchtigen könnten. Auf die nach seinem Wahlsieg in die Höhe geschossenen Kurse ist auch Trump stolz, weil sie für ihn persönliche Bereicherung bedeuten und die Vermögensanhäufung des oberen einen Prozents ihm als Messlatte seines politischen Erfolgs gilt.
Zugleich aber hat Trump im Wahlkampf die Einführung eines 20-Prozent-Grundzolls gegen alle Staaten der Welt und einen Zoll von 60 Prozent auf alle Warenimporte aus China versprochen. Aus Sorge um das Finanzkapital, dem er angehört, hat Bessent beschwichtigt, die 20-Prozent-Grundzollforderung sei lediglich ein »negotiating ploy«, um mit der Androhung von Handelsbeschränkungen verbesserte Handelsbindungen, Extraprofite durch verstärkte Patentregelungen und höhere Rüstungsausgaben seitens der NATO-Verbündeten zu erzwingen.
Auch diesmal hat Trump im Wahlkampf argumentiert, dass Importbeschränkung ein Machthebel sei. Zollpolitik als Waffe passt auch in sein Verständnis von Verhandlungen und seine Präferenz für bilaterale Deals. Zugleich hat er versprochen, dass die Zollerhöhungen die Senkung der Unternehmenssteuer und des Spitzensteuersatzes gegenfinanzieren sollen (statt wie nach 2017 die Staatsschulden und das Haushaltsdefizit dramatisch zu erhöhen). Womöglich zeichnet sich hier also ein Richtungsstreit ab, der dann auch einer mit Lutnick sein wird, der das Amt des Handelsministers ausüben wird. Im Gegensatz zu Bessent sieht Lutnick in Schutzzöllen die Grundlage für allgemeinen Wohlstand. Auch er ist Milliardär. Mit Trump verbindet ihn eine lange New Yorker Businessgeschichte.
Lutnicks Kapitalfonds »Cantor Fitzgerald« setzt auf Investment in Immobilien und den Handel mit US-Staatsanleihen, wofür er die Lizenz vom Staat hat. Auch vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass der künftige Handelsminister eher die Interessen des binnenorientierten Industriekapitals vertritt, das vor seiner mangelnden Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt geschützt werden soll. Die Schutzzollpolitik ist von Trump und Lutnick immer wieder im Namen der Arbeiterklasse bemüht worden, als Mittel zum Erhalt von Arbeitsplätzen. Der rechte Protektionismus hat einen wahren Kern, der ihn überhaupt erst plausibel macht, weil er im Gegensatz zum alten Neoliberalismus das Primat der Politik über die Wirtschaft zurückfordert. Zugleich ist dieser Wirtschaftsnationalismus eine gefährliche Illusion, weil Reindustrialisierung und das Anlocken von Auslandskapital mittels der Kombination von hohen Außenhandelszöllen und »Local Content«-Lieferkettenregelungen, verbunden mit neoliberalen Steuersenkungen und der Eliminierung von Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen, nie zum Gemeinwohl führen können. Eine solche Politik wird das »verlorene Paradies« der 1950er und 1960er Jahre, das die »Make America Great Again«-Ideologie nostalgisch herbeiruft, nicht wiederherstellen.
Trotzdem wirkt das Schutzzollversprechen als süßes Gift. Der Lebensstandard der US-Arbeiterklasse ist abhängig von Importen günstiger Konsumgüter aus den Entwicklungsländern. Die Entmachtung der Gewerkschaften im Westen und die daraus folgenden sinkenden Lohnquoten wurden ab den 1980er Jahren faktisch nur durch diese Form der Globalisierung des Kapitalismus kompensiert. Schutzzölle treffen nun aber eine ökonomisch verwundbare Arbeiterklasse, die sich die Teuerung der Importgüter nicht leisten kann. Sollte sich also der starke Lutnick-Flügel in der Trump-Administration durchsetzen, wird die Arbeiterklasse, die Trump zu großen Teilen gewählt hat, die Steuersenkungen bezahlen. Für eine nachhaltige Bindung der Klasse an Trump und die Republikanische Partei spricht das nicht.
Im Juni 2024 warnten 16 Wirtschaftsnobelpreisträger – darunter Joseph Stiglitz und Edmund S. Phelps – in einem offenen Brief, dass Trumps Schutzzollpolitik die Inflation »wieder anheizen« werde. Trotz Differenzen seien sie überzeugt, dass Bidens »Wirtschaftsagenda« mit ihrem Fokus auf »Infrastrukturinvestitionen, nationale Industrieproduktion und Klimaschutz« der Agenda »von Donald Trump weit überlegen« sei. Eine Studie der Volkswirte Kimberly Clausing und Mary Lovely bezifferte die zu erwartenden Einkommensverluste pro Privathaushalt auf 2.600 US-Dollar im Jahr, sollte es zur Einführung von 60-Prozent-Schutzzöllen auf alle Waren aus China und von 20-Prozent-Außenhandelszöllen auf Waren aller anderen Länder kommen. Das Peterson Institute for International Economics stellte für 2026 eine Inflationsrate von 6 bis 9,3 Prozent in Aussicht statt 1,9 Prozent, sollte Trump neben seiner Schutzzollpolitik auch die angekündigten Massendeportationen von mehr als zwölf Millionen Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung durchführen. Das würde zu einem erheblichen Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft führen.
China im Visier
Ein möglicher Kompromiss zwischen dem Bessent- und Lutnick-Flügel zeichnet sich ab, insofern Bessent zwar kritisch gegenüber dem dauerhaften Grundzoll von 20 Prozent ist, aber den Handelskrieg gegen China durchaus führen will. In einem Interview mit Bloomberg News vom August 2024 verknüpfte er seine Beteuerung, dass Zölle nur »einmalige Preisanpassungen« seien, mit der Aussage, dass sie ausschließlich gegen China gerichtet sein werden. Denkbar, dass er damit der Stärke des wirtschaftsnationalistischen Flügels Rechnung trägt. Lutnick weiß vor allem den Schattenpräsidenten Elon Musk auf seiner Seite, der als 486 Milliarden US-Dollar reicher Marktradikaler den Bundeshaushalt drastisch zusammenkürzen will und von Trump auch mit entsprechenden Kompetenzen versehen worden ist. Musk stellte sich nach den Wahlen auf Lutnicks Seite: In einem Tweet schrieb er, dass Bessent eine »Weiter-so-Wahl« sei.
Weitere Verbündete von Lutnick sind Jamieson Greer, der den Präsidenten in Handelsfragen berät, und Trumps oberster persönlicher Berater Peter Navarro. Der emeritierte Ökonom Navarro hat in Trumps erster Regierung zunächst den »Nationalen Handelsrat« des Weißen Hauses geleitet und anschließend das »Office of Trade and Manufacturing Policy«, das die wirtschaftsnationalistischen Kräfte in der Regierung als besondere Bastion neu geschaffen hatten. Greer wiederum war in der ersten Trump-Regierung als Stabschef des damaligen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer für die Schutzzollpolitik gegen China und die Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) zuständig.
Die Wirtschaftspolitik der USA ist darauf geeicht, den Wirtschaftskrieg gegen China noch einmal zu intensivieren. Womit die USA ihren relativen Abstieg als Hegemonialmacht aufzuhalten und die Verschiebung des weltwirtschaftlichen Schwerpunkts in den globalen Süden zu blockieren suchen. In diesem Ziel haben Demokraten und Republikaner Konsens. Wie auch im Ziel einer Reindustrialisierung, das schon von Obama ausgegeben wurde. Während die Biden-Regierung aber eine Mischung aus Schutzzöllen, Konkurrenz bei der Elektrorevolution und außenpolitische Einkreisungspolitik favorisierte, sehen die Trump-Republikaner den Kampf um die E-Revolution offenbar als verloren an und setzen eher auf das alte fossile Kapital und neoliberale Steuerpolitik zur Stärkung der Verbrenner produzierenden Autokonzerne.
Diese Orientierung teilt auch die neue Regierung. Energieminister wird Chris Wright, CEO von Liberty Energy, dem mit einem Marktwert von 3,2 Milliarden Euro zweitgrößten Frackinggas-Konzern Nordamerikas. Wrights persönliches Jahreseinkommen 2023 betrug 5,6 Millionen US-Dollar. Für Trump spendete er 228.390 Dollar. Wright leugnet, dass es eine Klimakrise gibt und betont, dass »wir uns nicht in der Mitte einer Energiewende befinden«. Sein erklärtes Ziel ist, die Maßnahmen der Biden-Regierung – einschließlich der Beschränkungen für CO2-Emissionen – rückgängig zu machen. Unter Wright und Trump werden die USA voraussichtlich auch wieder aus dem Pariser Klimaabkommen austreten.
Entscheidend wird sein, wie stark Trumps Bruch mit Bidens allgemeiner Konjunktur- und Infrastrukturpolitik ausfällt. Im Wahlkampf stellte er sich gegen deren tragende Säulen. Aber auch 2016 hatte er sich im Wahlkampf zunächst gegen Obamas Gesundheitsreform ausgesprochen, um »Obamacare« in seiner Amtszeit dann doch fortzuführen. Gegen die Fortsetzung der fiskalisch expansiven Wirtschaftspolitik wird Trump wohl von Stephen Miran beraten werden, dem designierten Chef des »Council of Economic Adviser«. Miran, »Senior Strategist« des großen Kapitalanlegers »Hudson Bay Capital Management«, arbeitete bereits von 2020 bis 2021 für die Trump-Regierung und den damaligen Finanzminister Steven Mnuchin. Er war in dieser Zeit ein Kritiker der Konjunkturpolitik der US-Notenbank in Reaktion auf die durch die Coronapandemie verschärfte Rezession.
Konfrontation statt Isolationismus
Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Darauf deuten nicht nur die Personalentscheidungen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik hin, sondern auch die in der Außenpolitik. Hierfür steht zunächst einmal der designierte Außenminister Marco Rubio. Wirtschaftspolitisch fügt sich der frühere Präsidentschaftskandidat nahtlos in die marktradikale Ausrichtung ein. Lange trat er als Freihändler in Erscheinung und engagierte sich für – das Kapitalprofite gegen demokratische Entscheidungen absichernde – Investitionsschutzabkommen »Trans Pacific Partnership«. Dann aber zeigte er sich als Unterstützer des Wirtschaftskriegs gegen China. 2017 setzte er sich dafür ein, dass der US-Staat chinesische Beteiligungen an US-Hightechfirmen im Namen der nationalen Sicherheit verbieten darf. Wenig später war er Mitinitiator eines parteiübergreifenden Briefs an das Heimatschutzministerium, das die zuständigen Minister zu einer Verschärfung der Sanktionspolitik gegen Huawei aufforderte. Außerdem legte Rubio eine Gesetzesinitiative vor, die Trumps Exekutivanordnung kodifizieren sollte, damit Huawei und andere chinesische Konzerne als eine Gefahr für die nationale Sicherheit vom amerikanischen Markt ausgeschlossen werden konnten. Im November 2018 warnte er in einem offenen Brief an Trump vor einer vermeintlichen Infiltration der Medien und Hochschulen durch Chinesen, um dann, wenige Wochen später, auch auf schärfere Maßnahmen zur Sanktionierung von europäischen und anderen internationalen Konzernen zu drängen, die Handel mit China treiben. Zudem forderte er im Februar 2019 weitere Gesetze, die chinesische Investitionen in den USA einschränkten und mit Sondersteuern belegten. Dem Finanzkapital warf er im Mai 2021 vor, »das kommunistische China zu unterstützen« und schwadronierte über eine ominöse »Linkswende unserer Konzerne und des Finanzsektors«. Im März 2023 forderte Rubio, dass zum Schutz der US-Industrie China der Status als normaler Handelspartner entzogen werde.
Keine Koexistenz mit »Barbaren«
Der Wirtschaftskrieg wird auch bei Rubio mit einer Politik der militärischen Einkreisung verknüpft, Regime-Change-Strategien eingeschlossen. Während der Hong-Kong-Proteste von 2014 und von 2019/2020 gab er dem unverhohlen Ausdruck. 2017 drängte er zusammen mit 16 weiteren Kongressabgeordneten auf die Verabschiedung des »Global Magnitsky Act«, nach dem chinesische Staatsbürger wegen Chinas Uigurenpolitik in Xinjiang sanktioniert werden können. Im Januar 2021 hatte Rubio Erfolg, als die von ihm vorgelegte Gesetzesvorlage »Uyghur Forced Labor Prevention Act« vom Kongress angenommen wurde, obwohl sich die Lage in der Provinz in den letzten Jahren entschärft hatte, Terroranschläge zurückgegangen, Straßenblockaden aufgehoben und »Internierungslager« aufgelöst worden waren. Nicht erfolgreich war Rubio ein Jahr später mit einer Gesetzesvorlage, die den mehr als 100 Millionen Mitgliedern der chinesischen Kommunistischen Partei verbieten sollte, in die USA einzureisen. Die ebenfalls 2022 in China ausgetragenen Olympischen Winterspiele verurteilte Rubio und bezeichnete die Volksrepublik als ein »genozidales Regime des Bösen«.
Die militärische Flanke der neuen Blockkonfrontation führt dabei über den Weg der Aufweichung der Ein-China-Politik. Die Biden-Regierung hat hier bereits wesentliche Schritte unternommen. Dazu gehörten erstens die Reise Nancy Pelosis nach Taipeh im August 2022, zweitens die mehrfache Betonung des Präsidenten, man werde Taiwan gegen eine chinesische Invasion nicht nur mit Waffen und Geld, sondern auch eigenen Truppen verteidigen, und drittens die im November 2023 beschlossene direkte Finanzierung der US-Aufrüstung Taiwans durch den US-Steuerzahler. Rubio geht noch weiter und plädiert offen für die Unabhängigkeit Taiwans. Insofern nun die Volksrepublik mit dem Status quo gut leben kann, weil Festlandchina und Taiwan wirtschaftlich eng verflochten sind und die Guomindang heute die wirtschaftliche Verflechtung der Insel mit der Volksrepublik befördern, die chinesische Regierung aber ein mit US-Waffen, womöglich atomaren Mittelstreckenraketen, aufgerüstetes Taiwan nicht akzeptieren kann, stehen die Zeichen in dieser Frage auf Sturm.
Auch andere Weltregionen betreffend gilt Rubio als Falke. Etwa beim Embargo gegen Kuba oder in Bezug darauf, ob es in der Ukraine zu einem Einfrieren des Konflikts kommt. Der USA-China-Konflikt, der Bedeutungsverlust des Westens und der Aufstieg des globalen Südens haben das Potential für rasch eskalierende Stellvertreterkriege in vielen Weltregionen. Das gilt auch für den Nahen Osten. Die Nominierung von proisraelischen Hardlinern wie der UN-Botschafterin der USA, Elise Stefanik, oder dem Sondergesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, sendet entsprechende Signale. Auch der künftige Außenminister ist für seine besonders harte Haltung gegen die Palästinenser bekannt. Zu letzterer gehören die Ablehnung der Zweistaatenlösung – Rubio bezeichnet sie als »eine Anti-Israel-Position« –, seine Zustimmung zur Anerkennung Jerusalems als Israels neuer Hauptstadt und die Unterstützung der rechtsextremen israelischen Regierung bei ihrer Kriegspolitik nach den terroristischen Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober 2022. Angesprochen auf die israelischen Kriegsverbrechen und die hohe Zahl an Ziviltoten im Ergebnis der KI-gestützten Kriegführung sagte Rubio gegenüber CNN: »Ich glaube nicht, dass irgend jemand von Israel erwarten kann, mit diesen Barbaren (im Original: savages, jW) zu koexistieren oder irgendeinen diplomatischen Kompromiss zu finden (…). Sie müssen ausgerottet werden.«
Rubios Außenpolitik wird komplettiert durch den prominenten Fox-News-Kommentator und designierten Verteidigungsminister Peter Hegseth. Vor seiner Tätigkeit als Talkshowmoderator bei Trumps Lieblingssender war Hegseth Teil des Wachpersonals im berüchtigten US-Foltergefängnis Guantánamo. Als Fox-News-Kommentator und Trump-Unterstützer war er es, der Trump 2019 zur Begnadigung von angeklagten und verurteilten US-Kriegsverbrechern ermutigte, darunter Eddie Gallagher, der für die versuchte Tötung von Zivilisten sowie die Ermordung eines minderjährigen Kriegsgefangenen unter Anklage stand. In seinem Buch »American Crusade. Our Fight to Stay Free« sprach sich Hegseth, der über enge Kontakte zu neonazistischen Gruppen verfügt, für einen »heiligen Krieg in der gerechten Sache der Freiheit« aus, wobei sein Verständnis von Freiheit die Abschaffung der »linken« Demokratie impliziert, da er davon ausgeht, dass der Gegensatz von links und rechts – Demokraten sieht Hegseth als »Feinde« der Freiheit an – sich nicht im politischen Prozess lösen lasse. Konkret prophezeite Hegseth für den Fall einer Wahlniederlage Trumps eine »nationale Scheidung« und plädierte für einen Militärputsch zugunsten Trumps: Polizei und Militär würden »in einer Form von Bürgerkrieg« gezwungen sein, »sich zu entscheiden«. Sein Buch sei in diesem Sinne auch als Grundlegung »der Strategie« gedacht, »die angewandt werden muss, um Amerikas innere Feinde zu besiegen«.
Im Amt will Hegseth nun nicht nur den »Wokeism im Militär« bekämpfen. Die Öffnung des Militärs für Homosexuelle betrachtete er lange als Teil einer »marxistischen« Agenda, heute wendet er sich nur noch gegen Transpersonen. Zugleich vertritt er die Position, dass »der Zionismus und Amerikanismus die Frontlinie der westlichen Zivilisation und Freiheit in der Welt« seien. Hegseth vertritt die rechtsextreme Great-Replacement-Theorie, nach der der Islam plane, Europa und Amerika zu erobern – im Bündnis mit dem Säkularismus. In Hegseth hat die Netanjahu-Regierung daher einen engen Verbündeten bei ihren Plänen, den Iran anzugreifen. »Das kommunistische China« wiederum, sagte Hegseth im Mai 2020, wolle »unsere Zivilisation beenden« und schaffe sich ein Militär, das »die Vereinigten Staaten von Amerika besiegen will«.
Deportation und Säuberungen
In der Innenpolitik, zu der wesentlich die geplanten Deportationen und die politischen Säuberungen gehören, gibt es ebenfalls Personalien, die es in sich haben. Trumps Beauftragter für Grenzschutz wird erneut der ehemalige Polizist Tom Homan. Homan ist ein Verfechter der Deportationspolitik und hat den »sanctuary cities« den Kampf angesagt. Als »Grenzzar« schon während der Obama- und dann in der ersten Trump-Administration war er Verfechter einer Politik, die Kinder an der Grenze von ihren Eltern trennte und sie separat in Abschiebegefängnissen internierte, um damit potentielle Einwanderer abzuschrecken. Nach Ende der ersten Trump-Regierung wurde er Fox-News-Kommentator und hat wesentlich am »Project 2025« und den darin enthaltenen Massendeportationsplänen mitgearbeitet.
Ingar Solty: Trumps Triumph? Gespaltene Staaten von Amerika, mehr Nationalismus, weitere und neue Handelskriege, aggressive Geopolitik. Eine Flugschrift, Hamburg: VSA-Verlag 2025, 120 S., 12 Euro
Raketen. Die Debatte um US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland ist von der Ukraine-Frage zu trennen.
Es geht um viel mehr.
von Wolfgang Richter, aus dem FREITAG, 19.12.2024
Die moralische Empörung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist berechtigt. Sie darf aber dennoch nicht den Blick für die strate-
gischen Realitäten trüben: Die ab 2026 geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland wird weder der Ukraine helfen noch die Sicherheit des Landes stärken, sondern die nukleare Rüstungskontrolle gefährden und strategische Risiken steigern. Mit Reichweiten von 1.700 bis 3.000 Kilometern würden Tomahawk-Marschflugkörper und Dark-Eagle-Hyperschallraketen von deutschem Boden aus Ziele im gesamten europäischen Russland bedrohen - erstmals seit 1991, als die letzten der nach dem NATO-Doppelbeschluss von 1979 stationierten Pershing-II-Raketen verschrottet wurden.
Die 40 bis 60 „Long-Range Fires" (LRF) plus Nachladungen, um die es geht, sind im Sinne des Systems der Rüstungskontrolle keine „überfällige Antwort" auf russische Iskander-Kurzstreckenraketen in Kaliningrad. Denn die fielen mit maximal 500 Kilometern Reichweite nicht unter den 1987 geschlossenen INF-Vertrag (Interme-diate-Range Nuclear Forces Treaty). Als Präsident Donald Trump diesen 2019 kündigte, ging es um die gM729-Systeme, die aus US-amerikanischer Sicht mit hohen Reichweiten den Vertrag verletzten. Allerdings wurden sie nie kooperativ verifiziert; in der Ukraine traten sie bislang nicht in Erscheinung.
Vielmehr hat Moskau am 21. November 2024 mit Oreschnik eine neue Mittelstreckenrakete „getestet", offenbar eine reichweitenverkürzte Variante der Interkontinentalrakete RS-26. Sie existiert in geringer Zahl, Präsident Wladimir Putin hat aber die Serienproduktion angekündigt. Damit reagiert er nicht nur auf ukrainische Angriffe mit amerikanischen und britischen Raketen auf Russland - sondern ausdrücklich auch auf die deutsch-amerikanische Erklärung vom 10. Juli 2024, jene LRF in Deutschland zu stationieren.
Trump wollte 2019 vor allem China dazu bewegen, dem INP-Vertrag beizutreten und auf die Raketen zu verzichten, die es um die Taiwan-Straße stationiert hat. Denn diese haben die Risiken für US-Interventionen in einer regionale Krise stark erhöht.
Um ihren Zugang zu solchen besonders geschützten Räumen zu erzwingen, haben nun alle US-Teilstreitkräfte kombinierte Verbände mit eigenen Mittelstreckenraketen und Marschflugkörpern aufgestellt.
Das Heer verfügte schon seit 2017 über „Multi-Domain Task Forces" (MDTF), die „Anti-Access/Area Denial"-Fähigkeiten des Gegners überwinden sollen. Drei der fünf MDTF richten sich auf den strategischen Schwerpunkt, den asiatisch-pazifischen Raum. Die zweite MDTF wurde indes 2021
- also vor dem Angriff auf die Ukraine - in Wiesbaden stationiert, während die zugehörigen Raketen zunächst im Bundesstaat New York verblieben. Sie sind es, die ab 2026 erst temporär, dann dauerhaft nach Deutschland kommen sollen.
Alles ist anders als 1979
Der sensible Raum, um den es den NATO-Planern geht, ist die „Suwatki-Enge". Zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus könnte NATO-Truppen der Landweg nach Litauen versperrt werden. Doch ist das nur 180 auf 100 Kilometer messende Kaliningrader Gebiet nur schwer zu verteidigen. So sind die fraglichen LRF weit mehr als ein operatives Gegengewicht zu den je zwölf Iskander-Systemen in Kaliningrad und Luga, die 2018 dort stationiert wurden und bis knapp vor Berlin reichen.
Weit über die Exklave hinaus könnten sie Moskau in zehn und den Ural in 15 Minuten treffen. So bedrohen sie Ziele im europäischen Russland, die für das nukleare Gleichgewicht wichtig sind. Ihre konventionelle Bestückung ist dabei unerheblich; sie können auch ohne Atomsprengkopf strategische Ziele zerstören.
Dies ist seit Jahren Gegenstand der bilateralen strategischen Stabilitätsgespräche zwischen Moskau und Washington, auch wenn diese seit 2022 nur noch informell stattfinden. Neben der regionalen Vorwärtsstationierung von LRF werden dort auch andere konventionelle Störfaktoren des nuklearen Gleichgewichts thematisiert, etwa die strategische Raketenabwehr. Dieses Gleichgewicht beruht auf gegenseitiger Vernichtungsfähigkeit.
Dazu muss die Überlebens- und Eindringfähigkeit atomarer Interkontinentalwatten gesichert sein, um einen vernichtenden Zweitschlag führen zu konnen. Wer dazu absehbar die Mittel nicht hat, müsste kapitulieren.
Um nun einen instabilen Rüstungswettlauf zu verhindern, haben sich beide Seiten seit Ennde der 1960er darauf verständigt, das nukleare Gleichgewicht durch bilaterale Verträge zu stützen. Zuletzt durch den New-START Vertrag (Strategic Arms Reduction Treaty) von 2010. Parallel sollte der ABM-Vertrag von 1972 (Ant Ballistie Missile Treaty) die strategische Raketenabwehr begrenzen, die gleichfalls die Zweitschlagfähigkeit bedroht. Die regionale Vorwärtsplatzierung präziser, eindringfähiger und durchschlagskräftiger Langstreckenwaffen wie der jetzt in Frage stehenden LRF könnte wiederum einen Erstschlag verstärken. Dann blieben nämlich weniger Zweitschlagwaffen, die von der Raketenabwehr mit höherer Wahrscheinlichkeit abgefangen werden könnten.
Ausschlaggebend für solche Lagebewertungen sind nicht wandelbare Absichtserklärungen, sondern technische Fähigkeiten. Zwar werden sie in beiden Lagern unterschiedlich beurteilt; aber um die Stabilität zu wahren, kommt es auf die jeweiligen Perzeptionen an. Daher tragen alle Schritte, die das Gleichgewicht unterminieren könnten, zur Verschärfung der Bedrohungsperzeptionen und zur Destabilisierung der Sicherheitslage bei.
Um eine globale strategische Raketenabwehr aufzubauen, hatten sich die USA 2002 aus ABM zurückgezogen. Dass sich dies nur gegen „Schurkenstaaten" wie den Iran richtete, hat Moskau nie geglaubt. Der Kreml sieht diesen Schritt als Gefahr für das strategische Gleichgewicht und hat mit neuen Systemen reagiert, um die US-Raketenabwehr zu überwinden - nuklear getriebene Langstreckentorpedos, Marschflugkörper globaler Reichweite und Hyperschallgleitkörper. Das wiederum sorgt die USA, sie wollen diese Systeme künftig in New START erfassen. Gleichzeitig streben sie aber eine Anhebung der quantitativen Obergrenzen oder eine temporäre Aussetzung des Vertrages an, um ein trilaterales Gleichgewicht mit der aufstrebenden Nuklearmacht China zu gewährleisten. Dagegen rechnet Moskau die Atomwaffen Frankreichs und Großbritanniens zum westlichen Arsenal.
Dass ab 2026 wieder von Deutschland aus strategische Ziele im europäischen Russland bedroht werden sollen, ist eine weitere Belastung der Stabilitätsgespräche. Und anders als beim NATO-Doppelbeschluss von 1979 wird die bilaterale Stationierungsentscheidung Washingtons und Berlins diesmal nicht von einem Dialog-Angebot an Moskau begleitet. Die strategischen Folgen sind schwerwiegend und relativieren die vermeintlichen operativen Vorteile der LRF, etwa die Fähigkeit, überraschend Ziele in der Tiefe Russlands anzugreifen - auch solche, die bisher nur durch frühzeitig erkennbare Interkontinentalraketen erreichbar waren. Diese Fähigkeit, russische Raketen zu „zerstören, bevor sie abgefeuert werden", also zuerst zu schießen, passt in kein plausibles politisches Szenario.
Moskau wird solche Waffen nicht bloß als Mittel der Abschreckung bewerten, sondern als Gefährdung des strategischen Gleichgewichts und der nationalen Sicherheit. Wegen der gegebenen geopolitischen Asymmetrie können landgestützte Mittelstreckenraketen nicht gegen die USA wirken, solange sie nicht in Kuba oder Venezuela stehen. Derartiges haben die USA in der Kuba-Krise von 1962 unter Androhung des Atomkriegs unterbunden. Die Stationierung solcher Waffen in Deutschland brächte nun Moskau in eine „Kuba-Situation".
Sollte der Kreml befinden, dass ein militärischer Konflikt unabwendbar ist, müsste er nach militärischer Logik diese Systeme präemptiv zerstören. Um einer existenziellen Gefährdung der Sicherheit Russlands zuvorzukommen, würde dabei der Einsatz taktischer Atomwaffen erwogen.
Wer das Risiko trägt
Die Risiken dieses Szenarios trägt Deutschland allein. Sie übersteigen deutlich die Bedrohung, der es als Drehscheibe für die Verteidigung der NATO-Ostflanke ohnehin ausgesetzt wäre. Denn es ginge dann nicht mehr um defensive Truppenbewegungen, die von deutschem Boden aus nach Polen und Litauen rollen, sondern um die Fähigkeit zum Überraschungsangriff gegen strategische Ziele in der Tiefe Russlands.
Es liegt daher im deutschen Sicherheitsinteresse, die Unterstützung der Ukraine klar zu trennen von der Bewertung der strategischen Folgen einer LRF-Stationierung. Um die strategische Stabilität und Sicherheit Europas zu gewährleisten, sollte Moskau angeboten werden, einen Wettlauf bei der Stationierung landgestützter Mittelstreckenraketen durch Dialog abzuwenden. Dies ist zentral für eine künftige europäische Sicherheitsordnung und muss bei einer Beilegung des Ukraine Konflikts mitbetrachtet werden.
Deutschland muss zurück zum Konzept der Risiko- und Lastenteilung, um eine strategische Isolierung zu vermeiden. Es ist bemerkenswert, dass die bilaterate Entscheidung Deutschlands und der USA, diese LRF auf deutschem Boden zu stationieren, im NATO-Kommuniqué vom selben Tag nicht einmal erwähnt wird. Das von Paris und Berlin geprägte Projekt ELSA (European Long-Range Strike Approach) ist etwas anderes: Es zielt darauf, die Reichweiten europäischer Marschflugkörper zu erhöhen und Bodenstartsysteme zu entwickeln, greift aber nicht in das strategische Gleichgewicht zwischen den USA und Russland ein.
Wiederum anders als 1979 will derzeit kein anderer europäischer Staat diese LRF auf seinem Gebiet sehen. Dafür gibt es gute Gründe. Weniger nachvollziehbar ist - nüchtern betrachtet und trotz des Ukraine-Kriegs - die neue sicherheitspolitische Dringlichkeit, mit der hierzulande die Stationierung der in Frage stehenden LRF begründet wird. Denn heute sind die verbündeten See- und Luftstreitkräfte mit 2.200 Kampfjets und mehr als 3.000 weitreichenden Marschflugkörpern in Europa Russland qualitativ wie quantitativ weit überlegen: Moskau verfügt nur über rund 1.200 Kampfflugzeuge - und sein Raketenpotenzial, das Kiew jüngst mit 1800 bezifferte. wird trotz hoher Produktionsraten im Krieg stetig dezimiert.
Dennoch wurde nun eine Maßnahme angekündigt, welche die Zukunft der nuklearen Rüstungskontrolle in Gefahr bringt. Wenn der New-START-Vertrag im Februar 2026 ohne Interimsvereinbarung ausläuft, gäbe es keine verbindlichen Begrenzungen eines atomaren Rüstungswettlaufs mehr. Deutsches Interesse muss es sein, die nukleare Rüstungskontrolle zu fördern - und nicht einen weiteren Grund für ihr Ende schaffen.
Wolfgang Richter (Oberst a. D.) war Leitender Militärberater in den deutschen UN- und OSZE-Vertretungen. Heute ist er Associate Fellow beim Genfer Zentrum f Sicherheitspolitik (GESP) - andere Veröffentlichungen auf der Seite der "Friedrich-Ebert-Stiftung" (FES)
weitere Infos z.B. hier beim IMI e.V.:
https://www.imi-online.de/2025/01/07/friedensfaehig-statt-erstschlagfaehig/
Die politische Mitte wirbt mit »gegen den Hass«. Dabei setzt der Faschismus auf Befriedung nach innen
Seit einigen Jahren gehört »Gegen den Hass« zu den Lieblings-Statements der selbst erklärten »Zivilgesellschaft«. Hunderte Kultur-, Medien- und Bildungsprojekte haben das Motto für Aktionstage und Kampagnen verwendet, die Publizistin Carolin Emcke mit einem gleichnamigen Buch 2016 den Friedenspreis des Buchhandels erhalten. Gemeint ist die Botschaft natürlich immer irgendwie faschismuskritisch. Der politische Extremismus so heißt es, sei schuld gewesen am Siegeszug der Barbarei. Hätten Nazis und Kommunisten nicht so abgrundtief gehasst, wäre die Weimarer Demokratie bewahrt und Auschwitz verhindert worden.
Hass und Harmonie in Weimar
Man muss kein*e Historiker*in sein, um zu erkennen, was für ein hanebücherner Unsinn mit dem Gegen-den-Hass-Talk verbreitet wird. Denn was hat der Nazi-Barbarei wohl eher den Weg bereitet: der Hass der Kommunist*innen, die Nazis noch 1933 aus ihren Vierteln prügelten, oder die bürgerliche Gemütlichkeit, mit der Konservative und Liberale Hitler erst zum Reichskanzler machten und dann mit allen Vollmachten ausstatteten? Geradezu entlarvend ist die Erklärung, mit der die »Parteien der Mitte« 1947 in einem Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg ihre Stimmen für das Ermächtigungsgesetz 1933 rechtfertigten: Man habe damals zugestimmt, um »möglichst viel von der Weimarer Demokratie in eine bessere Zukunft hinüber(zu)retten«. Meine Antwort auf die oben gestellte Frage ist klar: Hätte die deutsche Gesellschaft den Faschismus doch nur ordentlich gehasst!
Wenn man sich die zwischen 1933 und 1945 produzierten Kinofilme zu Gemüte führt, die auch heute noch zu Feiertagen über die Bildschirme flimmern (z.B. Heinz Rühmanns Endkriegsschmonzette »Die Feuerzangenbowle« von 1944), dann merkt man schnell, dass es ein zentrales Anliegen des Faschismus war, das Harmoniebedürfnis der Deutschen zu stillen. In vielerlei Hinsicht hätte sich die Kultur- und Medienarbeit des Nationalsozialismus mit dem Motto »Gegen den Hass« durchaus anfreunden können.
Das Erzeugen eines gemütlichen Grundgefühls war zentraler Pfeiler des faschistischen Befriedungsprogramms nach innen. Deshalb muss man – wie es der italienische Theoretiker Alberto Toscano vor einigen Monaten in einem »nd«-Interview getan hat – auch die These Hannah Arendts hinterfragen, faschistische Bewegungen zeichneten sich durch Massenmobilisierung aus. Genauer betrachtet, so Toscano, sei der Nationalsozialismus doch vor allem eine Bewegung zur Demobilisierung der Massen gewesen. Die NS-Massenaufmärsche hätten die Funktion gehabt, zu entpolitisieren und antagonistische Konflikte in der Gesellschaft unsichtbar zu machen.
Verbot der »Klassenverhetzung«
Tatsächlich bestand die historische Mission des Faschismus sowohl in Deutschland als auch in Italien darin, die Menschen »zusammenzuführen«. Nach den revolutionären Kämpfen der 1910er und 1920er Jahre galt es, das »Volk« miteinander zu versöhnen – vom Industriellen bis zum Tagelöhner. Der Kampf zwischen den Klassen und jede Ideologie, die den Hass zwischen diesen befeuerte, wurde deshalb unter Strafe gestellt.
Übrigens befand sich der Faschismus damit in bester bürgerlicher Tradition. Schon 1871 war im Deutschen Reich ein Gesetz für mehr Friedfertigkeit erlassen worden. »Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten gegen einander öffentlich anreizt, wird mit Geldstrafe bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft«, hieß es im Paragrafen 130, der allerdings nicht, wie der wohlmeinende Leser jetzt vermuten könnte, dazu gedacht war, Jüd*innen oder Roma vor Pogromen zu schützen. Vielmehr richtete sich das Gesetz gegen die »Klassenverhetzung«. Die rasant erstarkende Arbeiterbewegung sollte in Schach gehalten werden, indem man ihr verbot, über die Existenz einer herrschenden Klasse und deren Abschaffung zu sprechen.
Selbstverständlich stimmt es, dass der Faschismus stets auch ein »Außen« produziert, gegen das sich der Hass der Harmoniegemeinschaft richten soll: Hass auf Jüd*innen, die Sowjetunion, vermeintlich »Minderwertige«, Sinti und Roma und durchaus auch auf jene (allerdings gar nicht so zahlreichen) Liberalen, denen demokratische und Minderheitenrechte wichtiger waren als die Mehrung des Privateigentums.
Hass an sich ist gewiss nichts Positives. Aber umgekehrt sollten wir eben doch auch daran erinnern, dass »innerer Frieden« und »Gemütlichkeit« tragende Säulen des Faschismus sind. Wenn Goebbels’ Propagandamaschine neben sentimentalen Rühr- und Heimatstücken auch rassistische Hetze produzierte, darf das niemanden überraschen. Es sind zwei Seiten derselben Medaille.
Weniger einlullen lassen
Deshalb ist es sicher keine blendende antifaschistische Idee, wenn jetzt gefordert wird, »den Hass im Netz« per polizeilicher Strafverfolgung zu unterbinden. Es gibt Formen des Hasses, die viel zu wenig Raum bekommen: Hass auf soziale Ungleichheit, Unterdrückung, Ausgrenzung, menschliche Gleichgültigkeit und die Willkür der Staatsgewalt zum Beispiel. »Ein intensives Gefühl der Abneigung und Feindseligkeit« – wie der Hass enzyklopädisch definiert wird – ist nämlich notwendige Voraussetzung dafür, dass man Verhältnisse nicht einfach hinnimmt. Hier wären »mehr Hass« und »weniger Toleranz« durchaus angebracht.
Wenn sich Rassismus, Misogynie und Vernichtungsfantasien heute überall breitmachen, hängt das auch damit zusammen, dass ein emanzipatorischer Hass schwer vorstellbar geworden ist. Wenn sich niemand mehr dazu bekennt, dass die von oben geschaffene Normalität ekelhaft ist, richtet sich die allgemeine Frustration gegen Schwächere und »Andere«.
Mein Vorsatz für 2025 lautet deshalb: mich weniger einlullen lassen und entschlossener hassen.
An einer wesentlichen Unterscheidung würde ich dabei allerdings festhalten: Mein Hass soll sich nicht gegen Personen, sondern Strukturen richten. Emanzipatorische Kämpfe haben die Verhältnisse im Blick, die Personen wie Elon Musk und Björn Höcke hervorbringen – nicht die einzelnen, letztlich immer austauschbaren Individuen.
weitere Artikel von u.a. Raul Zelik - z.B. diesen hier:
Was ist Sozialismus heute? Warum wir den Kapitalismus überwinden müssen
In der Linken streitet man sich weiter über die richtige Haltung zum Ukraine-Krieg. Dabei liegen viele Antworten längst auf der Hand. (
Die Kriegsfrage ist bei weitem nicht das einzige Thema, über das sich die gesellschaftliche Linke in den letzten Jahren zerlegt hat. Doch wohl in keiner anderen Frage ist der Streit so existenzbedrohend wie hier. Vor allem für die Partei »Die Linke« wird die Luft allmählich dünn. Nachdem sich Sahra Wagenknecht mit ihrer These, dass linke Positionen zu Feminismus, Migration und Ökologie im Kampf um Wählerstimmen schon mal geopfert werden können, selbständig gemacht hat, droht zum Parteitag in Halle nun schon wieder die nächste Zerreißprobe.
Die Abstimmung Mitte September im EU-Parlament verhieß nichts Gutes: Auf die Frage, ob die Ukraine weitere Nato-Waffenlieferungen erhalten sollte, stimmten die drei deutschen Abgeordneten der Linken mit allen drei möglichen Optionen: Ja, Nein und Enthaltung. Kaum besser war es wenige Tage später bei der Friedensdemonstration zum 3. Oktober, deren wichtigste Forderung in der Aufnahme von Friedensverhandlungen bestand. Während die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch als eine der Hauptrednerinnen auf der Bühne sprach, bezeichnete die Parteiströmung »Progressive Linke« die Demonstration öffentlich als schweren Fehler, weil die Verantwortung Russlands am Krieg nicht benannt worden sei. Politische Klarheit sieht anders aus.
Dabei gibt es zweieinhalb Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs eine Reihe von Erkenntnissen, über die eigentlich nicht mehr gestritten werden müsste. Auf der einen Seite ist mittlerweile ziemlich klar, was das Hauptmotiv für die russische Kriegsentscheidung war. Auch wenn das militärische Vorrücken der Nato seit 1990 Moskau unter Druck gesetzt, war es – anders als häufig behauptet – keineswegs der entscheidende Grund. Denn mit dem Krieg hat sich der militärische Druck auf Russland weiter verschärft.
Viel plausibler ist deshalb die Erklärung, dass Moskau der ökonomischen Expansion des Westens und dem damit zusammenhängenden Zerbröckeln des postsowjetischen Machtbereichs Einhalt gebieten wollte. Oder anders ausgedrückt: Nachdem Russland im innerukrainischen Machtkampf um die wirtschaftliche Ausrichtung des Landes schwere politische Niederlagen einstecken musste, versucht es den Zerfall des politischen Einflussgebiets militärisch rückgängig zu machen. Die herrschende Klasse in Russland folgt damit einem subimperialistischen Kalkül: Wer in Anbetracht ökonomischer Unterlegenheit seine Interessen mit »regulären Mitteln« nicht durchsetzen kann, muss auf das Instrument des Krieges zurückgreifen. Subimperialistisch ist diese Politik, weil es sich bei Russland (ähnlich wie bei der Türkei oder dem Iran) um einen Akteur handelt, der mit »dem Westen«, sprich den USA und ihren Verbündeten, auf ökonomischer und technologischer Ebene nicht konkurrieren kann und dessen Machtansprüche deshalb regional begrenzt bleiben.
Umgekehrt hat sich in den vergangenen 30 Monaten aber auch gezeigt, dass die Annahme, demokratische oder menschenrechtliche Prinzipien seien beim »Westen« irgendwie besser aufgehoben als bei Russland, ein politisches Märchen ist. Die USA und die EU, die in der Ukraine das Völkerrecht zu verteidigen behaupten, unterstützen in Gaza und dem Libanon einen Krieg, der gemessen an seiner Brutalität gegen die Zivilbevölkerung das russische Vorgehen in der Ukraine noch übertrifft. Zwar mag »der Westen« über Israels Kriegsverbrechen nicht immer glücklich sein, weil diese die Verlogenheit der eigenen Politik vor Augen führen. Doch trotzdem unternehmen die Verbündeten nichts, um die systematischen Angriffe auf Zivilist*innen und mittlerweile sogar auf UN-Personal zu unterbinden – und das, obwohl Tel Aviv von den Waffenlieferungen und der Rückendeckung aus Washington vollständig abhängig ist. Dass Völkerrecht und Menschrechte hier plötzlich in den Hintergrund treten müssen, hat eine einfache Erklärung. Für den Westen ist Israel, wie es der US-Außenminister und Ex-General Alexander Haig in den 1980er Jahren ausdrückte, der »größte US-Flugzeugträger in einer für Amerikas nationale Sicherheit kritischen Region«.
Vor diesem Hintergrund müsste eine Position der »Linken« zu den eskalierenden Kriegen zunächst auf der Einsicht beruhen, dass es eben keineswegs um die Frage »Autoritarismus gegen Demokratie« geht. Zwar sind die Lebensverhältnisse in Russland heute zweifelsohne unfreier als in den USA oder der EU. Doch erstens wird der fortgesetzte Krieg auch bei uns für einen zügigen Freiheits- und Demokratieabbau sorgen, weshalb die Systemunterschiede schneller verschwunden sein könnten, als uns lieb ist. Und zweitens sind die politischen Differenzen eben nicht Kriegsursache. Hinter dem westlichen Engagement in der Ukraine steckt der eigene geopolitischer Machtanspruch. Und hier muss man deutlich betonen: Das transatlantische Bündnis aus USA und EU ist nicht nur nach wie vor der wichtigste Machtblock in der Welt, sondern verfügt auch mit Abstand über das zerstörerischste Waffenarsenal. Durch China und verschiedene subimperialistische Staaten herausgefordert, wird »der Westen« bei Bedarf nicht zögern, seine Gewaltmittel rücksichtslos einzusetzen.
An dieser Stelle wird häufig eingewandt, dass man den russischen Überfall auf die Ukraine nicht allein durch eine geopolitische Brille lesen dürfe. Die Argumentation geht in etwa so: Es mag ja sein, dass die Nato die Ukraine aus eigennützigen Motiven unterstützt, doch ähnlich wie die kurdische Selbstverwaltung in Rojava hat auch die Ukraine ein Recht, alle Hilfe zu nehmen, die sie bekommen kann. Richtig daran ist: Ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung (allerdings auch längst nicht alle) wünschen sich mehr westliche Waffenlieferungen. Doch immer fragwürdiger ist, ob sich mit den Mitteln des Staatenkriegs irgendetwas in Richtung Freiheit bewegen lässt. Bei den Artilleriegefechten an der ukrainisch-russischen Front sterben die Soldaten wie im 1. Weltkrieg als Bedienungspersonal einer industriellen Materialschlacht. Dazu kommt, dass es bei diesem Krieg um kapitalistische Staatenkonkurrenz geht, bei der der Grad der Oligarchisierung, nicht aber der oligarchische Charakter des Systems selbst zur Disposition steht. Mit dem Kampf in Rojava, wo die Guerilla auf den Prinzipien von Selbstorganisierung und Feminismus beruht und ein alternatives Gesellschaftsprojekt aufbaut, hat der Kampf des ukrainischen Nationalstaats wirklich kaum etwas gemein.
Auch im Staatenkrieg des 21. Jahrhunderts geht es nicht um Demokratie und Menschenrechte, sondern um die Sicherung von Wirtschaftsräumen.
Bei der Debatte um Waffenlieferungen sollte man folgendes betonen: Auch wenn die militärische Unterstützung der Nato eine schnelle Unterwerfung der Ukraine durch Russland verhindert hat, haben sich ansonsten fast alle Befürchtungen bewahrheitet. Um den russischen Rechtsextremismus zu stoppen, hat man die ukrainische Rechte gestärkt. Auf den Friedhöfen der Westukraine flattern heute die rotschwarzen Fahnen der rechtsextremen Bandera-Bewegung, als wäre das die normalste Sache der Welt. In den Schützengräben der Ukraine wird ein Krieg geführt, der in seiner nationalen Stumpfheit den Verbrechen des 1. Weltkriegs in nichts nachsteht. Und selbst ihre Unabhängigkeit hat die Ukraine längst verloren: Die westlichen Kreditgeber, die lange Erfahrung im Ausplündern rohstoffreicher Länder besitzen, werden sich nach Friedensschluss an der Ukraine gütlich tun. In Zeiten eines kriselnden Kapitalismus wird es weder einen Marshallplan noch Sozialprogramme für das gebeutelte Land geben.
Das größte Fiasko der europäischen Linken im 20. Jahrhundert war bekanntlich die Entscheidung der Sozialdemokratien, sich 1914 zur Nation zu bekennen und auf der Seite ihrer jeweiligen Eliten in den Krieg zu ziehen. Millionen Tote, der Siegeszug des Faschismus und ein 2. Weltkrieg waren die Folge. Diese Katastrophe hätte man vermeiden können, wenn mehr Linke rechtzeitig begriffen hätten, dass es eben nicht um den Konflikt »westliche Zivilisation gegen russischer Despotismus« oder »französischer Republikanismus versus preußischer Militarismus«, sondern um ganz banale kapitalistische Staatenkonkurrenz ging. Das Versagen der Sozialdemokratie bestand darin, nicht rechtzeitig für eine Internationale der Deserteure geworben zu haben.
Gewiss: 2024 ist nicht 1914. Aber einiges ist eben doch auch ähnlich. Auch im 21. Jahrhundert geht es im Staatenkrieg nicht um Demokratie und Menschenrechte, sondern um die Sicherung von Wirtschaftsräumen. Wer sich hier auf die Seite der Mächtigen im eigenen Land schlägt, hat schon verloren.
Seite 2 von 17