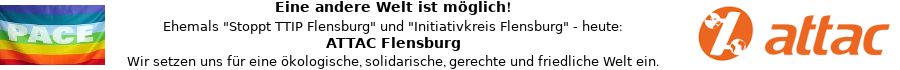Vorbemerkung: Wohl kaum eine Wirtschaftsjournalistin oder ein Wirtschaftsjournalist neben Ulrike Herrmann schafft es mit soviel Weitblick, auch für Laien verständlicher Schreibe und mit so präziser Argumentation wie Stefan Kaufmann die finanz-und wirtschaftspolitische Entwicklung unserer Zeit zu analysieren. Er schreibt regelmässig für die FR und das nd. (hn)
Stefan Kaufmann: erstellt am 23.01.2020
Im globalen Geschäft sind die Zeiten rauer geworden. Das wird sichtbar schon daran, dass sich Analysen der internationalen Wirtschaft zunehmend des Vokabulars der Kriegsberichterstatter bedienen. Die Zeit sieht Deutschlands Industrie im „Duell mit China". Mit der Annahme chinesischer Investitionen werde Italien zum „Brückenkopf" Pekings in Europa, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und die FAZ warnt davor, dass Tschechien zu „Chinas Flugzeugträger" in Europa werde.
Es droht - oder herrscht - Wirtschaftskrieg zwischen den großen Mächten. Die meisten liberalen Ökonomen reagieren darauf mit Unverständnis. Wenn Asien wachse, gebe es neue Möglichkeiten der Kooperation zum gegenseitigen Vorteil, argumentiert Jan Schnellenbach und fügt an: „Versteht doch mal, dass Marktwirtschaft kein Krieg ist!" Das stimmt. Aber mit Marktwirtschaft lässt sich Krieg führen.
Denn die neoliberale Idee des freien Spiels der Marktkräfte ist zurückgetreten. An ihre Stelle rückt eine Politik, in der die Sphären der Wirtschaft, der Finanzen, des Militärs und der Außenpolitik miteinander verschmelzen: Zur Geopolitik kommt die Geoökonomie. Europa, China und die USA schützen ihre Unternehmen vor Übernahmen durch das Ausland. Regierungen untersagen Geschäfte mit chinesischen Zulieferern wie Huawei, russischen Rohstofflieferanten wie Gazprom oder ganzen Staaten wie Iran. Sie rüsten ökonomisch auf, schaffen oder stützen nationale „Champions" und verlagern globale Wertschöpfungsketten in ihren Machtbereich. Sie finanzieren technologische Innovationen und bauen lokale Industriezweige - zum Beispiel für Batterien - auf, um vom Ausland nicht abhängig zu sein beziehungsweise um das Ausland von sich abhängig zu machen. Dies alles mit dem Argument, die nationale Souveränität zu erhalten.
Nun ist Gegnerschaft nichts Neues. Wirtschaft findet im Kapitalismus als Wettbewerb statt. Da das Miteinander als Gegeneinander organisiert ist, sind die Übergänge zwischen normaler Konkurrenz und „Wirtschaftskrieg" fließend. Im Geschäftsverkehr der Weltmächte sind jedoch neue Umgangsformen zu beobachten. Der eigene Misserfolg wird nicht länger als Ergebnis des Marktes wahrgenommen, sondern als Ausfluss eines bösen Willens der Konkurrenten. Die Gegenseite, so die Beschwerde, verhalte sich unfair, regelwidrig. Kooperation wird zur „Abhängigkeit", das Ausland von der Chance zur Gefahrenquelle.
Ziel ist, den Willen der Gegenseite zu brechen. Um dies zu erreichen, werden Maßnahmen getroffen oder angedroht, die die Kooperationspartner explizit schädigen oder schwächen sollen. Eventuelle eigene Verluste sind dabei eingeplant und akzeptiert. So hat Donald Trumps Handelspolitik die USA vergangenes Jahr per Saldo 1,4 Milliarden Dollar pro Monat gekostet, errechnen Ökonomen der Universitäten Princeton und Columbia. Doch das zählt für Trump nicht. „Spielt die EU nicht mit, werden wir sie zur Hölle besteuern", droht er. Die Gegenseite zu schädigen und selbst Schäden hinzunehmen erfolgt ohne unmittelbaren eigenen geldwerten Vorteil, sondern ist Mittel zum Zweck, den Partner zu kontrollieren. Man geht in den Konflikt. Auch wenn das oft anders beschrieben wird: Dieser Konflikt ist das Gegenteil von Abschottung.
„Wir sind nicht naiv"
Es sind neue Zeiten. Regierungen nutzen nicht mehr nur ihre Möglichkeiten, um heimischen Unternehmen per Liberalisierung den Weg freizuräumen. Vielmehr schränken sie vielfach den freien Markt ein, lassen seine Ergebnisse nicht mehr gelten und stellen sie unter politischen Vorbehalt. Der Wille ihrer Wirtschaft ist der Politik nicht mehr Befehl. Umgekehrt nutzt die Politik die heimischen Konzerne als Ressource, um ihre Nation im globalen Streben nach Dominanz zu stärken und die anderen zu schwächen. „Die Grenzlinien zwischen Kriegs- und Friedenszuständen werden immer undeutlicher", schreiben Nils Ole Oermann und Hans-Jürgen Wolff in ihrem neuen Buch Wirtschaftskriege.
Ökonomen müssen deshalb umdenken. Die liberale Fraktion hielt den globalen Handel stets für einen Verhinderer von Krieg. Denn wer miteinander Geschäfte mache und kooperiere, der sei vom Wohlergehen und Wohlwollen des Kontrahenten abhängig. Aber so einfach ist die Sache nicht. Das zeigt schon das Wort „Kontrahent", das den Vertragspartner wie auch den Gegner bezeichnet. In Frage gestellt wird aber auch die alte „linke" Annahme, Krieg werde nur für den Profit geführt - eine Annahme, die sich in Parolen wie „Kein Blut für Öl!" ausdrückte oder in Berechnungen, wie die Rüstungsindustrie von Kriegen profitiert. Was sich weltpolitisch derzeit abspielt - Brexit, Handelskrieg, Europas Kritik an chinesischen Investitionen -, das haben sich die Konzerne nicht bestellt, im Gegenteil: Es schadet ihnen zunächst.
Deutlich wird dies am Fall Huawei. Der chinesische Netzwerkausrüster verfügt über billige, gute Technologie, an welcher westliche Telekomkonzerne und Standorte Interesse haben. Dennoch sperrt Washington Huawei aus dem US-Markt aus und drängt die europäischen und asiatischen Staaten dazu, mitzutun. Damit wollen die USA Chinas Aufstieg zur Hightech-Macht unterbinden. Vizepräsident Mike Pence nannte die „technologische Vorherrschaft" der USA eine Bedingung für deren „nationale Sicherheit". Washington will verhindern, dass der chinesische Staat über Huawei Zugriff auf sensible Daten der USA oder anderer Staaten erhält. Die Möglichkeit, heimische Hightech-Firmen als Quelle für ausländische Daten zu benutzen, behält Washington sich selbst vor. Dass Peking mit Huawei das Gleiche versuchen könnte, begreift die US-Regierung als Angriff auf ihre digitale Einflusssphäre weltweit.
Schließlich will sie verhindern, dass Peking über die Ausrüstung ausländischer Netze ein politisches Machtmittel in die Hand bekommt, mit dem Huawei auf Anweisung der Regierung ausländische Netze gezielt stören könnte. Washington kalkuliert hier offensichtlich mit einer Eskalation. Denn „umfassende Störungen" von Netzen durch den Ausrüster sind laut der Stiftung SWP in Berlin „allenfalls im Falle massiver zwischenstaatlicher Auseinandersetzungen denkbar". Dann aber schon.
Die EU-Staaten wehren sich noch gegen Amerikas Huawei-Verbot, teilen aber die Bedenken gegen China. „Wir sind nicht naiv", sagt Thomas Gassilloud vom französischen Verteidigungsausschuss. Bei ihrer Entscheidung zu Huawei berücksichtige die Pariser Regierung „sowohl die Sicherheit der Netze wie auch unseren Platz im internationalen Wettbewerb". Sprich: Wettbewerbsfähigkeit allein zählt nicht mehr.
Altmaiers Nationalismus
In Deutschland klingt aus der „Nationalen Industriestrategie 2030" des deutschen Wirtschaftsministeriums ein „unverhohlen nationalistischer Ton", konstatiert der Ökonom Jeromin Zettelmeyer. Ziel der von Peter Altmaier als Wirtschaftsminister vorgelegten Strategie ist zum einen, den Anteil der Industrie in Deutschland zu erhöhen. Das ist eine Kampfansage. Denn dieses Ziel wäre nur zu erreichen, indem Deutschland den anderen Staaten Marktanteile abnimmt. Zudem sollen Wertschöpfungsketten der Unternehmen zunehmend nach Europa verlagert werden, „vermutlich weil sie dann widerstandsfähiger gegen geopolitische Störungen sind", so Zettelmeyer. Die Stärkung der Industrie soll laut Wirtschaftsministerium auch verhindern, dass Deutschland „strategische Sektoren" der Wirtschaft ans Ausland „verliert" und damit an „Souveränität" einbüßt. Um dieser Gefahr zu begegnen, sollen nationale Großkonzerne, „Champions", geschmiedet werden. Fallweise will der Staat die Übernahme deutscher Firmen durch das Ausland verhindern, auch mit dem Erwerb staatlicher Beteiligungen.
Gegen die deutsche Industriestrategie wenden Ökonomen ein, die politische Steuerung von Wertschöpfungsketten führe zu Effizienzverlusten. Doch für das deutsche Ministerium scheint wichtiger, dass diese Ketten unter politischer Kontrolle Deutschlands stehen. Gegen die Schaffung nationaler Großkonzerne wenden Ökonomen ein, derartige Champions seien nicht unbedingt rentabel. Für das Wirtschaftsministerium allerdings zählt hier nur eines: Sie sind deutsch.
Alles Ökonomische wird auf einmal zu einer Frage der Nationalität. Zwar gibt es massenweise Banken auf der Welt - doch will die Bundesregierung eine aus Deutscher Bank und Commerzbank fusionierte deutsche Großbank. Zwar ist weltweit effiziente Technologie verfügbar - doch kommt sie nicht aus Deutschland. Zwar existieren Zulieferer für die hiesigen Unternehmen - doch sind sie außerhalb der politischen Kontrolle der Bundesregierung. Zwar wollen viele Investoren sich an deutschen Unternehmen beteiligen - doch haben sie die falsche Nationalität. Das Ausland wird zum Risiko. Zur „Nationalen Industriestrategie" passt daher die Aufstockung des deutschen Militäretats und der Aufbau einer europäischen „Verteidigungsidentität".
Mit „Protektionismus" ist die gegenwärtige Lage nicht beschrieben. Keiner Seite geht es darum, die Konkurrenten sich selbst zu überlassen. Sondern darum, sie zu nutzen. Es ist auch keine Rückkehr des ökonomischen Nationalismus, denn der war nie weg. Den freien Welthandel betrieben die ökonomischen Großmächte nie aus Uneigennützigkeit, sondern als Mittel für ihren nationalen Wohlstand. Es scheint, als könnten sie diesen Wohlstand heute nur noch gegen den Widerstand des Auslands sichern und mehren. Die Regierungen sammeln daher ihre Potenzen, um diesen Widerstand notfalls zu brechen. Das ist kriegsträchtig.
Heute ringen die Weltmächte nicht mehr nur um Marktanteile und Wettbewerbsfähigkeit, also um ihre Position in der Konkurrenz. Sie kämpfen um die Gestaltung der Konkurrenz selbst, um die Regeln des globalen Geschäftsverkehrs und um ihre Machtposition. Dabei sind sie bereit, Wertschöpfung zu opfern. Um ihre Dominanz zu sichern, stellen die Regierungen der USA und anderer Mächte kurzfristige Profitinteressen zurück und nutzen ihre Wirtschaftskraft so als Waffe. So praktizieren nicht die Weltmarktverlierer, sondern die Weltmarktgewinner eine Globalisierungskritik von rechts - nicht im Namen der Klasse, sondern im Namen der Nation.