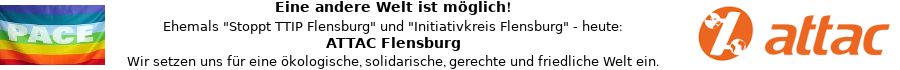Tomasz Konicz
Klimakiller Kapital. Wie ein Wirtschaftssystem unsere Lebensgrundlagen zerstört
Mandelbaum kritik & utopie, Wien/Berlin 2020
376 Seiten, 20,00 Euro - ISBN: 978385476-692-6
Die zentrale Aussage des Buches von Tomasz Konicz ist schnell zusammengefasst: Wenn der
Kapitalismus nicht bald überwunden wird, werden Klimawandel und Umweltzerstörung Formen
und Geschwindigkeiten annehmen, die die Erde zu einem für Menschen nur noch sehr bedingt
lebbaren Ort machen. Die Dringlichkeit, mit der das vorgetragen wird, steht manchem in keiner
weise nach, was aus radikalen Teilen der Degroissancebewegung und mit ihr verbundenen
Wissenschaftler*innen zu hören ist. Auch aus der marxistischen Linken kommen gelegentlich
ähnliche Töne.
Dennoch lässt Konicz keinen Zweifel aufkommen, dass dies nicht seine Ansätze sind. Schon in der
Einleitung erklärt er seine Intention, „dem ökologisch motivierten Verzichtsdenken wie auch dem
simplen Klassenkampfparadigma entgegenzuwirken“; es solle vielmehr „nachgewiesen werden,
dass beide Ansätze nicht weit genug gehen, da sie in den kapitalistischen Denkformen verfangen
bleiben: Verzicht, da Bedürfnisbefriedigung in Warenform gedacht wird; Klassenkampf, da der
Fetischismus und die Formen subjektloser Herrschaft ausgeblendet werden“ (S.17). Dabei wird der
Klassenkampf nicht abgelehnt, sondern er wird verstanden als eine auf Umverteilung des
kapitalistisch produzierten Reichtums gerichtete Praxis. Eine solche kann sehr wohl nützlich sein,
wird aber nicht zum Sturz des ökonomischen Systems führen, auf dem sie beruht: „Dem
Klassenkampf … wohnt keine objektive transformatorische Potenz inne.“ (S. 54)
Wer das Buch mit Gewinn lesen will, sollte also vom „Marxismus als hippes identitäres
Modeutensil oder anachronistische orthodoxe Ideologie“ (S. 25) Abschied genommen haben und
eine gewissen Kenntnis der wertkritischen Analyse mitbringen. Konicz bezieht sich dabei stark auf
Robert Kurz und man kann sich fragen, ob (sehr seltene) Seitenhiebe auf andere wertkritische
Verständnisse erforderlich waren. Der Kapitalismus wird in dieser Tradition als Herrschaftssystem
ohne herrschendes Subjekt verstanden, das in selbsttätiger Bewegung immer mehr Wert anhäufen
muss. Das gelingt nur, indem er Lohnarbeit verwertet, die er aber gleichzeitig im Prozess der
Produktivitätssteigerung in zunehmendem Maße durch „tote Arbeit“, Maschinen, ersetzt.
„Die Instabilität, die Krisenanfälligkeit, aber auch die zerstörerische Dynamik des kapitalistischen
Systems resultiert aus der marktvermittelten Tendenz des Kapitals, den Einsatz von Lohnarbeit im
Produktionsprozess zu minimieren. Dieser 'prozessierende Widerspruch', bei dem das Kapital
konkurrenzvermittelt seine 'Entsubstantialisierung' betreibt, ist nur in einer Expansionsbewegung,
bei der Erschließung neuer Märkte, Wachstumsfelder und insbesondere Industriesektoren
aufrechtzuerhalten. Das Kapital muss expandieren – oder es zerbricht an sich selbst.“ (S.32) Auch
„die Lohnabhängigen“ können sich dem nicht entziehen, weil sie „ja tatsächlich ihre soziale
Existenz nur dadurch aufrecht erhalten (können), indem sie Lohnarbeit leisten – und dies bedeutet
gesamtwirtschaftlich nichts anders, als den objektiv gegebenen Wachstumszwang des Kapitals
subjektiv zu exekutieren“ (S. 62). Und damit ist dies „die Wahl, die der Spätkapitalismus den
Lohnabhängigen lässt … : Arbeitslosigkeit und Verelendung jetzt oder Klimakollaps später“ (S. 84).
Es liegt auf der Hand, dass aus dieser Analyse keine euphorische Einschätzung von Plänen zum
ökologischen Umbau entstehen kann. „Grüner“ Kapitalismus oder „Green New Deal“ sind letztlich
Versuche, die materielle Basis eines reformierten Kapitalismus neu zu festigen. Dafür müssten diese
Sektoren aber bei wachsender Produktion und Produktivität zunehmend Lohnarbeit ausbeuten, was
sie nicht tun. Insbesondere die „Energiewende“ wäre „technisch längst machbar, aber die
kapitalistischen Produktionsverhältnisse behindern die volle Entfaltung der ökologischen
Produktivkräfte“ (S. 96).
In den folgenden beiden Kapiteln („Kampf um das Klima“ und „Kapitalistische Selbstzerstörung“)
geht es nicht mehr so stark um die Darlegung der grundsätzlichen Kritik als um die Betrachtung
konkreter Elemente der materiellen Basis des Ganzen. Das ist stimmig und die angesprochen
Beispiele sind erhellend. Allerdings beruht der Text zu großen Teilen auf älteren Arbeiten des
Autors, was sich manchmal als irritierend erweist. Auch im ersten Teil gab es Redundanzen, die
aber insbesondere für Leser*innen ohne engen Bezug zur Wertkritik vielleicht sogar hilfreich
waren. Jetzt werden sie manchmal störend. Besonders der Blick nach Lateinamerika erscheint durch
manchen älteren Bezugstext auch arg aus der Zeit gefallen. Die (nicht nur) in diesen Kapiteln
immer wieder angesprochene Theoretisierung eines kapitalistischen „Todestriebs“, oft in enger
Verbindung mit „Faschisierung“ formuliert, ist nicht ganz unumstritten, ohne dass das erwähnt
würde. Was allerdings durch Konicz' Art der Darstellung sehr gut deutlich wird, ist eine Folge, die
sich für immer mehr Menschen ergibt: Eine immer größere Zahl wird ökonomisch überflüssig. Sie
werden nicht nur für die Verwertung des Kapitals nicht gebraucht, sondern finden auch keine
ausreichenden Sektoren für Subsistenzproduktion mehr. Und deshalb sollen sie verschwinden,
zumindest unsichtbar werden; Fluchtbewegungen (gut herausgearbeitet vom Autor), Banden-,
Drogen- und andere Formen organisierter Kriminalität (nicht direkt erwähnt) und ganz allgemein
ihre Vernutzung im „Weltordnungskrieg“ (unter Verweis auf Robert Kurz' entsprechendes Werk)
sollen gleichzeitig „auch die Krise des Kapitals … 'ausschließen'“ (S. 269).
Wer nun erwarten würde, dass die radikale Kritik, der Konicz das gesamt System unterzieht, dazu
führte, dass er in Zynismus versinkt oder besonders (verbal-)radikale Auswege propagiert, würde
enttäuscht. Wer allerdings seine Arbeiten für Telepolis, Neues Deutschland oder Konkret kennt,
weiß, dass es ihm um wirkliche Veränderungen geht. Sein Kapitel über „Wege in den
Postkapitalismus“ ist sehr reflektiert und macht eine ganze Reihe von Vorschlägen, was an einer
lebensfähigen Zukunft Interessierte heute tun können. Die muss man nicht alle gut finden, tue ich
auch nicht, aber sie sind alle so gewählt, dass sie Zeit gewinnen würden, indem sie die
Destruktivtendenzen zurückdrängten, ohne sie allerdings auszusetzen. Schon die taktische
Unterstützung eines, im Kapitalismus eigentlich nicht machbaren, ökologischen Umbaus hatte er
empfohlen, aber auch „die zuerst rein reformistische – Einführung eines bedingungslosen
Grundeinkommens“ scheint ihm „– aller binnenkapitalistischen Widersprüchlichkeit einer solchen
Maßnahme zum Trotz –“ ein Schritt, der „der Neuen Rechten ein wichtiges soziales
Massenreservoir nähme“ (S. 341).
Eines allerdings, darauf besteht Konicz, darf man nie tun: Man darf nie Illusionen darüber bestehen
lassen, dass man aus der Klima- und Ökokrise rauskäme, wenn der Kapitalismus bestehen bleibt.
Man muss „sagen, was Sache ist“ (S. 343), und das ist, dass „das Kapitalverhältnis“ ganz
grundsätzlich überwunden werden muss, und das geht „nur als globale Totalität“. Deshalb kann
auch „die Nation … nicht mehr als positiver Bezugspunkt antikapitalistischer Praxis dienen“. Neue
Anläufe müssen vielmehr mindestens „wirtschaftliche Großräume“ in den Blick nehmen und wären
auf „Schützenhilfe … vonseiten einer globalen antikapitalistischen Bewegung“ angewiesen (S.
354f).
Das Buch kann zur Entstehung einer solchen durchaus beitragen, macht es doch klar, dass da kein
von alleine irgendwann auftretendes „revolutionäre Subjekt“ existiert, sondern dass die Verbindung
der konkreten Kämpfe und ihre Zusammenfassung als antikapitalistische Transformationsbewegung
eine Aufgabe der Kämpfe selber ist.