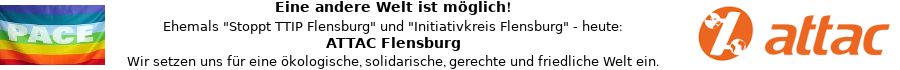Ein Beitrag von Raul Zelik (Schriftsteller, Mitglied im Parteivorstand Die LINKE)
Die Medien-Empörung über das Interview mit dem JUSO-Vorsitzenden Kevin Kühnert zeigt v.a. eins: dass die bürgerliche Gesellschaft es gar nicht gern sieht, wenn über die wirklichen Machtverhältnisse gesprochen wird. Nämlich über das Eigentum. Oder genauer gesagt: über die Vermögen der Großindustriellen, Fondsinhaber, Banker und Milliardenerben. Der Familien Quandt, Albrecht, Schwarz, Reimann, Klatten, Otto, Würth sowie ihrer Manager. Es geht bei der Diskussion nämlich nicht um den Handwerkerbetrieb oder die eigene Wohnung, sondern um das große Vermögen der oberen 0,5 Prozent.
Eigentlich liegt auf der Hand, dass Demokratie und ihre Freiheiten eine Farce bleiben, solange wenige fast alles, andere fast nichts besitzen. Angeblich sind wir alle gleich und haben alle die gleiche Stimme. Aber in Wirklichkeit können sich einige wenige TV-Sender kaufen, Think Tanks gründen oder Lobby-Unternehmen beauftragen und so dafür sorgen, dass ihre Interessen auch berücksichtigt werden.
Kevin Kühnert hat zwei richtige Dinge im Interview gesagt: Erstens sind die großen Vermögen nicht von Unternehmensgründern und schon gar nicht von den heutigen Eigentümern erwirtschaftet worden, sondern von ihren Belegschaften. Das Vermögen der Quandts (die übrigens nicht nur mit BMW, sondern auch mit der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus viel Geld verdient haben) ist deshalb selbst schon ein Ergebnis von Enteignung. Keine Arbeit ist so wertvoll, dass sich damit ein Milliardenvermögen anhäufen ließe. Die lateinische Wortwurzel verweist übrigens darauf: privare bedeutet rauben oder berauben. Privat ist das, was Einzelne der Allgemeinheit abgenommen haben.
Die Armut der Einen und der Reichtum der Anderen sind zwei Seiten von ein und der selben Medaille.
Zweitens ist es ein Unding, dass in unserer Gesellschaft nicht die Bedürfnisse der Menschen, sondern die Profite entscheiden. Das wird in Anbetracht von Klimawandel und neuem Wettrüsten immer mehr zur Überlebensfrage. Wir müssen unsere Gesellschaft, die Produktionsweise, den Lebenszuschnitt und die internationalen Beziehungen grundlegend verändern. Wir alle wissen das. Warum passiert es dann nicht? Weil heute nicht entscheidend ist, was die Menschen brauchen, sondern was Gewinn erwirtschaftet. Eine ökologische und solidarische Wende kann es deshalb nur geben, wenn Eigentum demokratisiert und Privatinteressen zugunsten von gesellschaftlichen zurückgedrängt werden. Die Eigentumsfrage ist nicht die Lösung aller Probleme, aber sie ist Grundlage dafür, dass überhaupt wieder demokratische und solidarische Lösungen möglich werden.
Dazu kommt aber noch etwas Drittes, das im ZEIT-Interview keine Rolle gespielt hat: Für sehr viele Güter ist Eigentum sowieso ein völlig falsches Konzept. Dem Verständnis von Eigentum liegt zugrunde, dass es veräußert werden kann. Aber Natur, städtischer Raum, soziale und öffentliche Dienstleistungen (wie Erziehung, Gesundheit, Nahverkehr usw.) sollten überhaupt nicht gehandelt werden können.
Klingt das nach DDR? Nicht wirklich, denn in der DDR agierte der Staat wie ein Eigentümer und befand sich selbst in den Händen einer kleinen Gruppe von Parteiführern. Wir streiten für etwas grundlegend anderes, nämlich für eine Demokratisierung sämtlicher Lebensbereiche. Auch der Wirtschaft! Nicht der Markt, sondern wir alle müssen entscheiden, ob und wie viel geflogen wird, was mit der Rüstungsindustrie geschehen soll, wie wir die Arbeit anders verteilen. Das Wort „Sozialismus“ kommt von „Gesellschaft“, nicht von „Staat“, und deshalb ist Gemeineigentum auch nicht dasselbe wie Staatseigentum.
Vor 70 Jahren – nach der Katastrophe der freien Märkte 1929, dem Siegeszug des Faschismus und des Weltkriegs – wussten das selbst einige Konservative. Im Grundgesetz ist deshalb nicht definiert, wie die Wirtschaft aussehen soll; die Vergesellschaftung von Unternehmen ist ausdrücklich vorgesehen. Selbst die CDU forderte in ihrem „Ahlener Programm“ von 1947 die Sozialisierung von Schlüsselindustrien.
Was wir nicht brauchen, ist eine Rückkehr des allmächtigen bürokratischen Staates, in dem Funktionäre entscheiden, was gut für alle ist. Was wir brauchen, ist eine Stärkung von demokratischem Gemeineigentum und Gemeinnutzung in den unterschiedlichsten Formen: genossenschaftlich, öffentlich-rechtlich, als Allmende, mit Belegschaftsdemokratie usw.
Was wir fordern, ist deshalb eigentlich auch gar keine Enteignung, sondern das genaue Gegenteil: ein Stopp der alltäglichen Enteignung durch Niedriglöhne, Kapitalrenditen und Mietenwahnsinn.