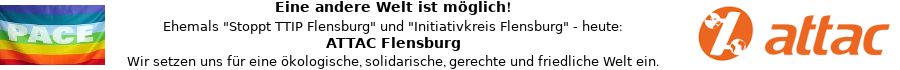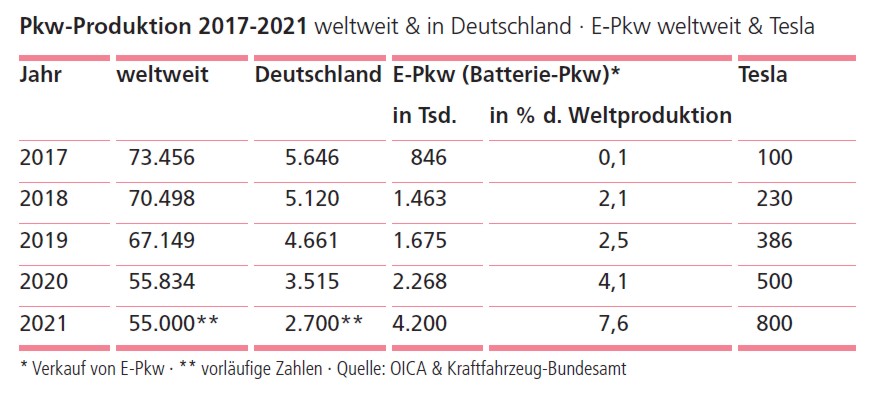Als am 23. März dieses Jahres das gigantische Containerschiff »Ever Given« im Suezkanal auf Grund lief, sich schräg stellte und damit die Schiffahrtsrinne sechs Tage lang blockierte, waren die Folgen für die Weltwirtschaft enorm. Zwölf Prozent des gegenwärtigen internationalen Warenverkehrs passieren den Kanal. Der wirtschaftliche Schaden belief sich täglich auf rund zehn Milliarden Dollar.
Der Vorgang zeigte unmissverständlich an, wie verwundbar das System der internationalen Lieferketten ist, wie sehr deren reibungsloses Funktionieren unter anderem davon abhängt, dass das Nadelöhr Suezkanal nicht verstopft. Ein Verständnis des gegenwärtigen Kapitalismus ist ohne eine Analyse der globalen Lieferketten nicht zu haben. Dabei folgt die internationalisierte Produktion, global integriert und netzwerkartig strukturiert, gar nicht so sehr einem linearen Verlauf, wie es das Bild von der Kette nahelegt.
Mangel an Überfluss
Mitte Oktober lagen weltweit etwa 600 Containerschiffe vor großen Häfen wie Hamburg, Antwerpen, Rotterdam, Shanghai und Shenzhen, da sie aufgrund der Überlastung der Hafenanlagen nicht anlegen und ihre Fracht löschen konnten. Vor dem Hafen von Long Beach beispielsweise, der größten Im- und Exportschnittstelle der USA, bildeten sich lange Schlangen von Lastwagen. Derzeit sieht es danach aus, als könnten die akuten Unterbrechungen der globalen Lieferketten bis ins nächste Jahr andauern, vor allem weil die Delta-Variante des Coronavirus in Asien weiterhin zu Fabrikschließungen führt. So hat die chinesische Regierung, die eine konsequente Zero-Covid-Politik betreibt, den drittgrößten Containerhafen der Welt, den Hafen von Ningbo, im August teilweise stillgelegt, da das Virus bei einem Hafenarbeiter festgestellt worden war.
Die Stockungen im globalen Warenfluss wirken sich weltweit ganz erheblich auf die Preisentwicklung zahlreicher Güter aus. Lebensmittel, Rohstoffe und andere Handelswaren hatten sich zu Beginn des Jahres bereits verteuert. Aktuell steigen die Warenpreise ebenso wie auch die Frachtkosten weiter. Wie die Financial Times Mitte Oktober schrieb, hat sich der Preis für das Verschiffen eines Containers aus Asien nach Europa diesen September im Vergleich zum Mai des vergangenen Jahres verzehnfacht.
Laut dem Vorstand von DP World, einem der größten Containerhafenbetreiber weltweit, ist »die westliche Welt« in zu hohem Maße abhängig von der verarbeitenden Industrie in China. Importabhängige Länder wie die USA und Großbritannien leiden momentan unter einem Mangel an Kraftfahrern und Hafenarbeitern. In den USA sollen unter Dockarbeitern bereits 24-Stunden-Schichten an der Tagesordnung sein. Den größten US-amerikanischen Logistik- und Frachtunternehmen wie UPS und Fedex fehlt es schlicht an Arbeitskräften. Die US-Regierung hat bereits eine Sonderkommission eingerichtet, um das Lieferkettenproblem in den Griff zu bekommen.
Die Lieferausfälle beruhen darauf, dass das System der internationalen Taktung und Synchronisation der Transportwege infolge der Pandemie jäh außer Tritt geraten ist. Die Erklärung von Marktwirtschaftsgläubigen, wonach eine plötzlich steigende Nachfrage (im Westen) der Grund für die jetzige »Lieferkettenkrise« sei, ist, wenn an ihr überhaupt etwas dran sein sollte, zumindest mit Vorsicht zu genießen.
Ähnlich wie in der Finanzindustrie hat die »Diversifikation«, das heißt hier die Verteilung oder Streuung der Lieferketten auf verschiedene globale Regionen und Produktionszweige, zusammen mit der Öffnung der Märkte zu einer Konzentration auf bestimmte Knotenpunkte geführt. Elektronische Halbleiter, Lebensmitteldünger, Autoteile etc. werden über jene Lieferkette transportiert, über die sie am günstigsten – und das heißt auch: am schnellsten – von A nach B verbracht werden. Das bedeutet zwar flexiblere Verfügung über Produktion und Transport, erhöht aber die Anfälligkeit: der Ausfall eines Elements, die Verteuerung von Öl, von Transportcontainern, ein fehlendes Bauteil, gesteigerter Arbeitsaufwand in einer Fertigungsanlage, die Verspätung eines Schiffes etc. können für einen Kurzschluss sorgen, der sich unmittelbar auf die Lieferketten anderer Produktionszweige auswirkt. Sollten bestimmte Kostenfaktoren einer Lieferkette (Treibstoff, Container, Arbeitskräfte) steigen, lohnt sich womöglich die Investition in diesen Handelszweig schlicht nicht mehr. Die Lieferkette muss sich neu zusammensetzen oder entfällt ganz einfach. Die vielbeschworenen Preissignale des Marktes entfalten hier ihr destruktives Potential. Die eng getaktete Just-in-time-Produktion reduziert zwar drastisch die Kosten der Warenlagerung, doch wenn auch nur ein einzelnes Glied in diesem Prozess von Produktion und Transport ausfällt, hat das Rückwirkungen auf alle weiteren Glieder der Kette.
Logistische Revolution
Das, was bisweilen als logistische Revolution bezeichnet wird, zeichnet sich vor allem durch die Entwicklung des Containersystems und der Containerschiffahrt aus, die sich in den 1960er Jahren etablierte. Ähnlich wie die Logistik selbst ihren Ursprung in der militärischen Planung der Napoleonischen Kriege hatte, war die Planung und Organisation des Vietnamkriegs durch die US-Armee ein erstes Testfeld für standardisierte Container. Die Idee, Verladezeit und Löschungskosten mit Hilfe von großen Containern zu reduzieren, geht auf den US-Amerikaner Malcolm P. McLean zurück. Das erste Containerschiff, die »Ideal X«, ein umgebauter Öltanker, wurde von McLeans Reederei 1956 auf die Fahrt von Newark nach Texas geschickt. Obwohl es in Europa bereits vor dem zweiten Weltkrieg standardisierte Transportcontainer gegeben hatte, setzten sie sich erst nach Beginn des Vietnamkriegs durch.
Die internationale Standardisierung der Container ermöglichte den Transport unter Nutzung und Verbindung verschiedener Maschinen – von Schiffen, Kränen und Güterzügen – und setzt der zeitaufwendigen Arbeit des manuellen Verladens einzelner Gütern ein Ende. Die Maße des Standardcontainers – etwa sechs Meter lang und rund zweieinhalb Meter breit wie hoch – wurden unter der Bezeichnung »Twenty Foot Equivalent Unit« (TEU) zur internationalen Maßeinheit für Frachtvolumen. Ein solcher Container fasst ein Gewicht von bis zu 21 Tonnen. Aktuell werden zwischen 80 und 90 Prozent des globalen Warenverkehrs über die Containerschiffahrt abgewickelt.
Der rasante Ausbau der Frachtschiffindustrie in den vergangenen zehn Jahren, der in der Vergrößerung der Häfen weltweit und im irrationalen »Wettrüsten« der Frachtunternehmen, das größte Schiff mit der höchsten Kapazität zu bauen, zum Ausdruck kommt, ist der Grund für erhebliche Überkapazitäten. Symptomatisch drückt sich diese Hybris des Wachstums etwa im »Logistics Performance Index« der Weltbank aus. Dieser profitgetriebene Wettlauf hat nun nicht nur zu wiederkehrenden Transportunfällen geführt, sondern auch dazu, dass die Kolosse ihren Frachtraum häufig gar nicht voll beladen konnten – kurz, es gab mehr Schiffe als zu transportierende Güter. Nach Angaben der US-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Charmaine Chua lagen im November 2016 ganze 263 Frachtschiffe mit einem vakanten Frachtvolumen von 934.000 TEU unbeladen vor Anker – zu diesem Zeitpunkt waren das etwa fünf Prozent der globalen Flotte. Im gleichen Jahr meldete Hanjin, das damals größte Frachtcontainerunternehmen Südkoreas, aufgrund von Überkapazitäten seiner Flotte Konkurs an. 90 Schiffe, 540.000 Container und Güter im Wert von 14 Milliarden US-Dollar blieben monatelang unbewegt, 3.000 Seeleute hatten keine Beschäftigung und kein Auskommen.
Die gigantische »Ever Given« mit ihrer Transportkapazität von 20.124 TEU, die im März den Suezkanal blockierte, ist in mehrfacher Hinsicht ein Sinnbild für das globale Ausmaß der Lieferketten: Eigentum einer japanischen Leasingfirma, die sich wiederum im Besitz der größten japanischen Werft befindet, registriert in Panama, betrieben von einer taiwanischen Reederei, bereedert von einem deutschen Management und besetzt mit einer indischen Crew. Der Koloss ist das Produkt einer Eigendynamik, immer größere Containerschiffe zu bauen, um, angefacht von der Konkurrenz der Unternehmen, den Umschlag der Waren weiter zu beschleunigen. Seit Beginn der 1970er Jahre sind die Frachtkapazitäten um das Fünfzehnfache gestiegen. 2013 hielt ein »Triple E«-Schiff der Reederei Maersk den Rekord von 18.000 TEU, während das Unternehmen heute Frachtschiffe mit einer Kapazität von 20.000 TEU unterhält. Die französische Schiffahrtsgesellschaft CMA CGM hat bereits Verträge über den Bau von Schiffen mit einer Last von 23.000 TEU abgeschlossen.
Die Erklärung dieser Gigantomanie findet sich in der Spekulation auf fortwährendes Wachstum, das dem Kapitalismus gleichsam als Naturgesetz eingeschrieben ist. Der Warenverkehr muss wachsen, alles andere wäre dem Profit abträglich. Schiffahrtsunternehmen sind Teil von Investitionsstrategien und der internationalen Finanzspekulation; Häfen sind als Infrastrukturinvestitionen genau wie Schiffe und Frachtraten interessante Objekte für den kredit- und schuldenbasierten Finanzmarktkapitalismus geworden. Das eröffnet breite Spekulationsmöglichkeiten auf Lieferzeiten, Transportrouten, Lebensmittelpreise, das Wetter etc.
Auch wenn es angesichts der aktuellen weltweiten Lieferengpässe kontraintuitiv erscheint – das exorbitante Wachstum der Containerschiffahrt und ihrer Kapazitäten war eben keine Reaktion auf eine wachsende Nachfrage, die Triebfeder war vielmehr, die Waren schneller zu befördern. Der Fall der Profitrate im Westen wurde mit den sich bietenden Möglichkeiten der Containerschiffahrt und einer damit gegebenen Verkürzung der Umschlagzeit »geographisch« pariert, wie Liam Campling und Alejandro Colás in ihrem Buch »Capitalism and the Sea: The Maritime Factor in the Making of the Modern World« schreiben. Durch die logistische Organisation und die Vergünstigung im globalen Frachtwesen konnten Firmen ihre Fabriken in den globalen Süden transferieren, schneller Material transportieren, den Lagerbestand drastisch reduzieren und vor allem in kürzerer Zeit den (schuldenbasierten) Konsum im globalen Westen bedienen. Die Erhöhung der Frequenz im globalen Warenhandel ermöglichte neue Wege der Akkumulation und der Just-in-time-Produktion, die im wesentlichen auf logistischen Entwicklungen der Schiffahrt beruhen.
Just in time
Die sogenannte Just-in-time-Produktion wurde bereits in den 1970ern von Toyota als Teil des Toyota Production System (TPS), einer holistischen Managementtheorie, entwickelt und in der Autoherstellung angewandt. Im Westen feierte man die Neuerungen im Produktionsmanagement als revolutionäre neue Praxis und Philosophie und übertrug sie, oftmals in rudimentärer Form, auf die eigenen Produktionsabläufe.
Angestrebt wird mit dem TPS eine effiziente und nach rationalen Kriterien operierende Gestaltung der Produktion. Dabei werden die Fertigungszyklen genau gemessen, um Lagerbestände zu vermeiden, In- und Output einer Fertigungsanlage synchronisiert, Bauteile erst dann bestellt, wenn auch das zu erzeugende Produkt in Auftrag gegeben wurde. Idealerweise kommen Lagerbestände so gar nicht erst auf, die Produktion soll sich möglichst eng mit der Zulieferung verzahnen. Das macht die Just-in-time-Produktion in hohem Grade abhängig von zuverlässigen Lieferketten und zugleich sehr anfällig, wenn letztere unterbrochen werden. Schon 1997 ging Toyota beinahe bankrott, als ein Feuer in der Fertigungsanlage eines Röhrenzulieferers die gesamte Produktion des Autobauers mehrere Tage lahmlegte.
Der US-Publizist Jasper Bernes beschreibt die Abläufe der Just-in-time-Produktion als eine paradox anmutende »Zeitreise«, insofern sie scheinbar dafür sorge, dass nur Produkte hergestellt werden, die bereits vorher an den Endverbraucher verkauft worden sind.¹ Produktions- und Lagermanagement sind über effiziente Informationsverarbeitung direkt mit der Distribution, den Einzelhändlern und deren Angebot verschaltet. Innerhalb dieses Paradigmas werden die Informationen sofort an das Produktionssystems rückübertragen. Die Produktion wird Teil der Zirkulation und umgekehrt.
Mit dem Ende des klassischen Fordismus im Westen und der keynesianistischen Organisation des Kapitalismus bildete sich etwa ab 1973 eine globale Organisation der Produktion heraus, deren Kennzeichen unter anderem eine Dezentralisierung der Produktion (Outsourcing) ist und die den Produzenten, etwa transnationalen Konzernen, ermöglicht, Ressourcen und Produktionskreisläufe so zu konfigurieren, dass sich die Kosten der Produktion verringern. Das liegt zum einen an der technischen Entwicklung auf der Ebene der Produktion, aber auch an den Kommunikationsmedien, die Logistik und Transport entscheidend geprägt haben.
Just-in-time-Produktion verlangte aber neben technischer Infrastruktur und den Transportmitteln noch etwas anderes. Anders als oft dargestellt, ist der sogenannte Neoliberalismus weniger durch ein Verschwinden des Staates geprägt als vielmehr durch eine andere Form staatlicher Lenkung und Durchsetzung des Marktes im In- und Ausland. Staatliche Akteure schaffen erst die rechtlichen Rahmenbedingungen für neue Akkumulationsregime. Die Industriestaaten öffneten so dem international operierenden Kapital mittels Handelsverträgen und internationalen Abkommen die Märkte des globalen Südens. Mit der politischen und ökonomischen Dominanz der Staaten des Nordens gestaltete das so mobilisierte Kapital die Produktion im globalen Süden gemäß den Bedürfnissen ihrer Lieferketten.
Flexibel und gelenkt
Staatlich vereinbarte Freihandelsverträge wiederum erfüllten eine weitere Voraussetzung für das System der internationalen Lieferketten: den weltweiten Zugriff auf Arbeit und deren flexible Organisation und Kontrolle – in den Worten von David Harvey »ein flexibles Akkumulationsregime«, dessen Ziel es ist, den Kapitalertrag mit Hilfe einer geographischen Reorganisation der Produktion zu steigern (»The Condition of Postmodernity«, 1990). Als Beispiel zur Veranschaulichung des neuen Produktionsparadigmas wählte Harvey die Firma United Colors of Benetton. Ein T-Shirt wird in China genäht, um dann in Indien gefärbt zu werden, während das Design in New York entwickelt und die Werbung von einem Büro in London entworfen wird, die Steuern wiederum in Irland abgerechnet werden. Das Beispiel United Colors of Benetton zeigt die Flexibilität moderner Unternehmen indes nicht nur in der Art und Weise der Produktion, sondern auch dahingehend, dass es auf das je spezifische Produkt gar nicht so sehr ankommt. Vermöge der weltweiten Verfügung über Arbeitsmärkte, Technik und Ressourcen kann schnell ein neues Produkt entworfen, können Produktionszweige abgestoßen und neue Absatzmärkte (nicht nur im Westen) erschlossen werden. In Windeseile lässt sich ein komplett neues Geschäftsmodell etablieren, ohne an eine schwerfällige materielle Infrastruktur gebunden zu sein, da die Fabriken und andere Produktionsstätten überhaupt nicht mehr fester Bestandteil des Unternehmens sind.
Welche Waren entlang der Lieferketten befördert werden, ist zweitrangig. Der Vizepräsident von Nike Asia erklärte einmal, dass er und sein Team gar keine Ahnung von Textilherstellung hätten, sie seien Designer und Marketingexperten. Vom Wichtigsten spricht der Manager des Sportartikelherstellers allerdings nicht: günstige Produktionsverträge in Asien, kurz, die Institutionalisierung von Sweatshops.
Man könnte in bezug auf die Lieferketten beinahe von einer globalen Trennung geistiger und körperlicher Arbeit sprechen: Organisiert werden sie oft von einem eigens beauftragten Unternehmen bis hin zur Produktion und Herstellung (»Tangibles«), während die Firma selbst sich vor allem um Marketing, Design und das Brand Development kümmert (»Intangibles«), was für die Wertschöpfung auf den westlichen Märkten eine ungeheure Bedeutung bekommen hat. Die wichtigsten Funktionen innerhalb der Lieferkette sind durch den Käufer bestimmt, während kleinere Firmen und Unternehmen, die Teile von ihr sind, nur begrenzte Möglichkeiten haben »aufzusteigen«. Sie bilden nur einen modularen Bestandteil der Lieferkette, stehen in Konkurrenzdruck zu anderen Firmen und sind dementsprechend auch leicht zu ersetzen.
Ungefähr ein Drittel des Welthandels erfolgt »intra-firm«, d. h. der Handel findet zwischen Firmen und Händlern statt, die einem führenden Unternehmen untergeordnet sind, das die Entscheidungen über materielle, finanzielle und »menschliche« Ressourcen in großen Teilen in der Hand hat. Die Untersuchung der Wertschöpfung entlang internationaler Lieferketten (»Global Value Chains«, GVC) macht daher deutlich, dass die Rede von den freien Märkten bloß strategische und ideologische Funktion hat. Globale Produktion und globaler Handel werden größtenteils von wenigen westlichen Unternehmen gelenkt und organisiert. Der Profit bewegt sich in diesem Gefälle ganz klar in eine Richtung: nach Norden. Das leitende Unternehmen zieht seinen Nutzen aus lokalen Wettbewerbsvorteilen, Produktionsfortschritten und Effizienzsteigerungen seiner Anbieter in den Entwicklungsländern. Die Entwicklung der sogenannten New Industrializing Countries (NIC) vor allem in Asien und Südamerika erklärt sich gewissermaßen umgekehrt proportional zur Deindustrialisierung des Westens.
Schrankenlose Konkurrenz
Wer schafft nun den globalen Reichtum in den Sweatshops der Niedriglohnländer? Im Grunde gilt für das weltumspannende flexible Akkumulationsregime der Lieferketten, was Karl Marx zur »sogenannten ursprünglichen Akkumulation« dargestellt hat: Es bedarf einer »Landnahme«, das Eigentumsverhältnis muss kapitalkonform zugerichtet, die Produktion Teil der Zirkulation und die Arbeiterklasse, Quelle des abstrakten Reichtums, überhaupt erst »gemacht« werden.
Die globale Warenwirtschaft hat mit dem Aufkommen der »Globalisierung« eine Gleichzeitigkeit von historischen Formen der Ausbeutung geschaffen. Ob Manufakturen und Fabrikhallen in Asien, die an den frühen britischen Kapitalismus mit seinen Arbeitshäusern erinnern, die informellen, patriarchalen Formen von Arbeit, etwa wenn Familienmitglieder hierzulande nachts im Kiosk arbeiten, oder auch die Leiharbeit in Deutschland, das Heer prekärer »Soloselbständiger« oder die befristet Beschäftigten: Es besteht ein Nebeneinander aller denkbaren Formen der Ausbeutung, d. h. der Verfügung über Arbeit nach Maßgabe des flexiblen Akkumulationsregimes. Nicht nur im globalen Süden. Auch wenn die rechtlichen und tatsächlichen konkreten Arbeitsbedingungen dort in vieler Hinsicht um einiges desolater sind. Hier gilt, was Marx in der Einleitung zum »Kapital« dem deutschen Arbeiter zuruft, der achselzuckend und optimistisch fragt, was die Zustände der damaligen Arbeiter in England mit ihm zu tun hätten: »De te fabula narratur!« (»Über dich wird hier berichtet!«)
Der Konkurrent ist die weltweite Reservearmee, nicht nur der ungelernte Arbeiter von nebenan. Die neue Mobilität des produktiven Kapitals schafft einen globalen Arbeitsmarkt, der, seit dem Beginn der 1980er Jahre im Westen von der Desintegration gewerkschaftlicher Organisation flankiert, den Druck auf die Löhne erhöht. Auch hier hat der Staat mit neoliberalen Reformen der Beschäftigtenrechte die Grundlage geschaffen, lokale Arbeitsverhältnisse nach den Maßstäben des neuen Akkumulationsregimes zu formieren. Während die globale logistische Infrastruktur das Rückgrat der Lieferketten bildet, sind es die staatlich gesetzten rechtlichen Regelungen und internationale Handelsabkommen, die die globale Durchsetzung neuer Produktionsmodelle ermöglichen. Die logistischen Netzwerke schaffen die Grundlage zur Durchsetzung von kapitalistischen Machtkonfigurationen auf internationalem Niveau, die Staaten den Rechtsrahmen zur Disziplinierung und Kontrolle der Arbeitskräfte.
Das betrifft auch unmittelbar die Organisation der Arbeit in der Produktion, die von Subunternehmen direkt mit den Rhythmen der Lieferketten synchronisiert wird. Ob in einem Amazon-Lager oder in einer chinesischen Fabrik für Halbleitertechnik, die Kontrolle der Arbeit ist den logistischen Gegebenheiten unterworfen. Das in vielen Teilen computerisierte oder algorithmisierte logistische System übt unmittelbare Kontrolle über die Arbeit und ihre Organisation aus.
Internationale Lieferketten bestehen aus kontingenten, informellen und instabilen Arrangements, die zwischen verschiedenen Firmen, Transportunternehmen und Ländern bestehen und die, wie es Anna Tsing ausdrückt, häufig experimentellen und in mehrfacher Hinsicht grenzüberschreitenden Charakter besitzen, da ihre Etablierung auf der Verbindung von Arbeitsregimes in verschiedenen Ländern und Kulturen basiert.² Dazu gehören Arbeitsmigration, Subunternehmertum (Leiharbeit), die gezielte Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen oder anderen Minderheiten, ohne dass der Konzern, der sie »regiert«, für diese Unterdrückungsformen selbst zur Verantwortung gezogen wird.
Institutionalisiertes Arbeitsunrecht, patriarchale Strukturen, Rassismus, staatliche Unterdrückung und Kolonialismus sind oft lokale Phänomene und als solche der Lieferkette »äußerlich«. Das Verhältnis von Kapital und Arbeit wird entlang von intersektionalen Ausprägungen der Ausbeutung konfiguriert und reproduziert. Sogenannte kulturelle Diversität ist nicht nur ein Modewort in den Konzernetagen, sondern auch ertragreich durch diversifizierende Formen der Ausbeutung durch Arbeit. Neben quasi »organischen« Formen, beispielsweise in traditionellen und patriarchalen Familienstrukturen, existieren vollkommen losgelöste Formen der Arbeit, etwa auf den Weltmeeren in der Containerschiffahrt, die eigentlich gar keiner kulturellen Vermittlung mehr folgen. Alle können sie gleichzeitig wertzusetzender Teil einer Lieferkette sein.
Und der Widerstand?
Die Dezentralisierung der Produktion entspricht dem Outsourcing und der Dezentralisierung der (organisierten) Arbeit. Waren Minen, Häfen, die Seefahrt und das Transportwesen, historisch gesehen, immer Hotspots für den organisierten Widerstand der Arbeiter, trägt heute die kulturelle Markierung »migrantische Arbeiter« zu einer Entsolidarisierung und Vereinzelung bei. Unter welchen Umständen können die jetzigen Schaltzentren der globalen Warenproduktion und -zirkulation zu lokalen Brennpunkten des internationalen Widerstands der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen das Kapital werden? Angesichts der internationalen Organisation der Ausbeutung von Arbeit liegt eine internationale Assoziation der Arbeiterinnen und Arbeiter mehr als nahe. Die existierende grenzüberschreitende Organisation von Beschäftigten in Konzernen wie Amazon könnte dafür beispielgebend sein. Der Kapitalismus hat kein singuläres Zentrum, das sich angreifen ließe. Der Stuhl, auf dem er sitzt, hat viele Beine, an denen es zu sägen gilt.
Anmerkungen
1 Jasper Bernes: Logistics, Counterlogistics and the Communist Perspective. Online: endnotes.org.uk/issues/3/en/jasper-bernes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect
2 Anna Tsing: Supply Chains and the Human Condition. In: Rethinking Marxism. A Journal of Economics, Culture and Society 21 (2009) Nr. 2, 148–176