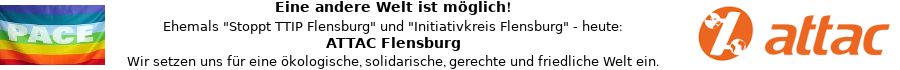»Kollaps ist kein Weltuntergang«
Klimaaktivist Tadzio Müller übers Scheitern der Klimaschutzbewegung und das solidarische Leben, das daraus entstehen könnte
Ihr gerade erschienenes Buch »Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps« besteht aus einer Sammlung von Texten, die eine Mischung aus Essay und Brief an die Klimagerechtigkeitsbewegung darstellen. Sie stammen aus Ihrem Blog »Friedliche Sabotage«, den Sie seit 2022 schreiben. Wie entstanden die Ideen zum Blog und zum Buch?
Um es ganz offen zu sagen: Zuerst war das Ziel des Blogs eine Monetarisierung meiner Strategiearbeit für die Klimabewegung. Von Anfang an war das Schreiben auch eine Art Selbsttherapie. 2022 begann die Letzte Generation auf die Straße zu gehen, wurde von allen gehasst, und die Regierung zeigte sich unwillig, das Klima zu schützen. Gleichzeitig verarbeitete ich das Ende einer schlimmen Beziehung, die von gegenseitiger emotionaler Brutalität und zu vielen Drogen geprägt war. Mir fiel auf, dass diese Dinge, die ich privat erlebt hatte, die politische Entwicklung erklären können, viel besser als jede politische Theorie. Also entwickelte ich eine eigene Analyse. Zwei Jahre später bekam ich mit, dass sich viele Menschen dieselbe Frage stellten: Warum redet trotz Klimakatastrophe niemand mehr über Klimaschutz? Damit entstand Anfang 2024 die Idee zu meinem Buch als eine Art politpsychologischer Ratgeber. Ich glaube, viele progressiv denkende Menschen sehen gerade eine tiefe Dunkelheit beim Blick auf die Welt – und da will ich sie abholen. Nicht mit politischer Theorie, sondern bei ihren Gefühlen.
Die einzelnen Texte decken einen Zeitraum von zwei Jahren ab, in dem Sie Ihre Ansichten immer wieder überdacht haben: 2018 haben Sie noch daran geglaubt, dass die Gesellschaft offen für rationale Argumente ist. Ein Jahr später, als die Bundesregierung trotz großer Fridays-for-Future-Demos das völlig unzureichende Klimapaket verabschiedete, änderte sich das.
Genau – wie in meiner damaligen Beziehung. Mein Ex-Partner hat mir immer wieder Dinge versprochen, die auch in seinem eigenen Interesse waren, hielt sich aber nicht daran. Ich verstand das nicht: Warum handelt er so irrational? Und warum handelt diese Regierung so irrational, deren Interesse es eigentlich sein müsste, das Klima zu schützen? Jedes gebrochene Versprechen führt zu Scham und diese wiederum zu Verdrängung, auch in der gesamten Gesellschaft.
Ist es nicht ein wenig überheblich, den Ex-Partner auf die Gesellschaft, die verdrängt, zu projizieren und sich selbst als personifizierte Klimabewegung mit den rationalen Argumenten darzustellen?
Ja, ist es. Aber mir geht es dabei ums Personalisieren einer Geschichte. Ich teile meine Erfahrungen und Gefühle, die andere Menschen nachempfinden können. Wie ich merkte, dass alles, wofür ich mein bisheriges Erwachsenenleben gekämpft habe, nicht funktionierte; dass die Klimabewegung gescheitert ist.
Sie schreiben, der Konflikt zwischen Klimabewegung und Verdrängungsgesellschaft eskalierte Anfang 2023, als der nordrhein-westfälische Ort Lützerath für die darunter liegende Braunkohle geräumt wurde. Sie waren in einem besetzten Haus dabei und haben dort wieder Hoffnung geschöpft. Dabei wurde Lützerath doch abgerissen.
Als ich in Lützerath ankam, war ich psychisch am Ende. Ich kam in ein besetztes Haus mit etwa 20 anderen, völlig unterschiedlichen Aktivist*innen. Und innerhalb von vier Tagen wuchsen wir durch den äußeren Druck und die gemeinsame Mission so eng zusammen, dass sich alle umeinander kümmerten. Wir wurden zwar geräumt, aber ich hatte auch etwas wiedergefunden. Nämlich die Verbindung zur Bewegung. Und dann ist mir klar geworden, dass Selbstwirksamkeit und Hoffnung nicht unbedingt vom Sieg abhängen, sondern vom Erlebnis eines gemeinsamen Kampfes. Wir werden die klimagerechte Revolution gegen den fossilen Kapitalismus nicht schaffen – aber wir können die Zielvorstellung ändern. Das war der absolute Wendepunkt meiner Depression.
In Ihren früheren Texten schreiben Sie, die Letzte Generation sei der einzige Akteur der Bewegung mit einer angemessenen Strategie. Später bezeichnen Sie dann auch deren Blockaden als gescheitert. Warum?
Der zeitliche Aspekt muss dabei beachtet werden. Anfang 2022 war die Strategie der Letzten Generation richtig. Ich erkläre es mal mit einer Fußball-Metapher: Wenn ich 2:0 zurückliege und es sind noch 15 Minuten zu spielen, ergibt es Sinn, eine Auswechslung vorzunehmen und viele Stürmer nach vorne zu stellen. Das macht in der 89. Minute aber keinen Sinn mehr. Dann muss ich nur noch dafür sorgen, dass meine Spieler nicht verletzt werden, denn das Spiel ist schon verloren. Im Herbst 2023 lagen wir schon 4:0 hinten, und die Nachspielzeit war angebrochen. Nun war es an der Zeit, über das nächste Spiel nachzudenken. Genauso war die Fridays-for-Future-Strategie vernünftig, solange bis sie gescheitert war. Die politische und gesellschaftliche Situation hatte sich innerhalb von zweieinhalb Jahren extrem verschoben – von einer, in der Klimaschutz eventuell noch möglich war bis hin zu einer Situation, in der er nicht mehr erreicht werden kann.
In einem weiteren Kapitel erklären sie Demos, Blockaden und alle anderen Strategien für gescheitert. Andere Aktivist*innen halten aber an der Vielfalt von Taktiken fest, auch um weniger militanten Menschen eine Teilhabe zu ermöglichen. Wie stehen Sie dazu?
Davon halte ich nicht viel. Im Grunde heißt das ja, dass alle weiter »business as usual« machen, aber damit gewinnen wir nun mal nichts. Dann hat man im Grunde auch aufgehört, Aktivismus ernst zu nehmen, in dem Sinne, etwas verbessern und gerechter machen zu wollen.
Aber die Menschen vertreten bei Demonstrationen doch eine Haltung.
Ja, aber was die Menschen denken, ist nicht so wichtig wie das, was sie tun. Wenn Leute sagen: »Ich will Klimaschutz, aber ich mache nichts dafür«, dann ist das nicht genug. Wir sollten schon hinterfragen, ob unser Aktivismus noch etwas bringt. Der globale Klimastreik im September zum Beispiel war deprimierend. Es kam kaum noch jemand, weil längst widerlegt ist, dass wir nur auf die Straße gehen müssen und es dann irgendwann Klimaschutz gibt. Verdrängung existiert aber auch in der Klimabewegung, die ihr eigenes Scheitern verdrängt. Sie macht immer weiter die gleichen Aktionen, obwohl die meisten Leute schon wissen, dass es nichts bringt. Ich sage ja nicht, dass alle militanter werden müssen. Ich sage nur, dass wir hinterfragen müssen, ob solche Demos noch der Situation angemessen sind oder eher Ressourcenverschwendung.
2023 kommen Sie zu dem Schluss, dass es für Klimaschutz zu spät und der Kollaps, im Sinne einer Instabilität des Klimas, nicht mehr aufzuhalten sei. Daher gehe es nun vielmehr darum, den Kollaps sozial gerecht zu gestalten, als weiter für Klimaschutz zu kämpfen. Aus Schweden haben Sie die Idee des »solidarischen Prepping« (solidarisches Vorbereiten) mitgebracht. Ist das nicht ein bisschen wenig?
Da muss natürlich noch mehr kommen. Das kann ich mir aber nicht allein im stillen Kämmerlein überlegen. Meine Aufgabe als Bewegungsintellektueller ist es, sich anzuschauen, was Menschen jetzt schon tun. In Schweden gibt es ein riesiges Drogengang- und Gewaltproblem. Da werden regelmäßig jugendliche Drogenkuriere im Wald erschossen oder sterben, weil die Krankenwagen nicht schnell genug kommen. Dort habe ich gesehen, wie Menschen sich einander beigebracht haben, Wunden zu versorgen und das zu tun, was das Gesundheitssystem nicht mehr leisten kann. Das ist total ermächtigend. Prepping verbinden wir heutzutage vor allem mit rechten Individualpreppern, die Vorräte anlegen. Tatsächlich geht es aber um den Aufbau sozialer Beziehungen. Das ist für mich der Anfang einer Praxis im Kollaps. Kollaps bedeutet nicht gleich Weltuntergang, sondern dass ein System instabil wird – sei es durch einen Mangel an Strom, Medikamenten oder Weizenprodukten. Und Anerkennung des Kollapses bedeutet nicht, dass wir aufgeben, sondern dass wir solidarische Netzwerke schaffen, die die entsprechenden Leistungen bereitstellen.
Sind Besetzungen, wie aktuell die Waldbesetzung in Grünheide, nicht ein gutes Beispiel für Kollaps-Aktivismus? Deren Ziel ist der Aufbau solidarischer Parallelstrukturen, Kern des Aktivismus ist das gemeinsame Leben.
Ich glaube, es entsteht gerade eine Art Klimakampf 2.0. Der zeichnet sich zuerst dadurch aus, dass er nicht mehr an die Regierenden appelliert. In dem, was er tut, setzt er selbst um, was er will. Zweitens beinhaltet er das Selbstlernen von Fähigkeiten. Bislang müssen wir nichts über Medizin oder Landwirtschaft wissen – das machen andere in unserem System. Aber wenn das System kollabiert, müssen wir Wissen und Kompetenzen teilen. Und drittens findet er im Kontext begrenzter Ressourcen statt. Besetzungen werden sicherlich ein Teil des Klimakampfes 2.0 sein.
Klimakollaps: «Die Arschlochgesellschaft feiert gerade ihr Coming-out»
Krieg, Klimakrise und nun auch noch Trump. Wir müssten der düsteren Zukunft in die Augen schauen und uns organisieren, sagt der Berliner Klimaaktivist Tadzio Müller.

WOZ: Herr Müller, die linke Erzählung der letzten Jahre lautete: Die Rechten sind zwar stark, aber am Ende werden sich progressive Bewegungen zwangsläufig durchsetzen, weil sich der Fortschritt immer durchsetzt; und wir brechen in eine schöne, gerechtere, ökosoziale Zukunft auf. Spätestens mit Donald Trumps zweiter Wahl zum US-Präsidenten taugt diese Beschreibung der Zustände nicht mehr, oder?
Tadzio Müller: Wir Linke können Niederlagen traditionell gut verkraften, weil wir an das Dogma glauben, dass wir die letzte Schlacht gewinnen werden. Oder wie es der Bürgerrechtler Martin Luther King einst sagte: «Der Bogen des moralischen Universums ist lang, aber er neigt sich der Gerechtigkeit zu.» Wenn wir nun jedoch auf die Klimakrise schauen, müssen wir sagen: Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass die Faschisten «die letzte Schlacht» gewinnen, als dass wir das tun werden.
Wir erlebten auch früher schon verschiedene Krisen und Kriege gleichzeitig. Das fundamental Neue ist, dass über all dem die Bedrohung durch die Klimakatastrophe schwebt. Spätestens bis 2030 hätten reiche Länder ihre Emissionen radikal reduzieren müssen, nun kommt in den USA 2025 Donald Trump an die Macht, unter dem es wohl keinen globalen Klimaschutz mehr geben wird. Das ist erst einmal extrem deprimierend.
Ja, aber was man sich schon vergegenwärtigen muss: Joe Biden hat mehr Gasbohrungen zugelassen als Trump in seiner ersten Amtszeit. Es ist ja so ein linksökologischer Mythos, dass progressive Parteien bessere Klimapolitik machen als rechte. Der Kern des Problems ist der globale Massenproduktionskapitalismus, der nun einmal die planetaren Grenzen sprengt. Klimapolitik ist eigentlich keine ideologische Frage, sondern eine Wachstumsfrage. Auch die Sozialist:innen gingen davon aus, dass die Welt immer mehr produzieren würde. Sie hatten einfach andere Vorstellungen von der Kontrolle über die Produktion, von Eigentum und Verteilung. Die Idee, dass wir kollektiv glücklich werden in einem Reich der Überproduktion – die hatten alle. Und die Einsicht, die gerade die Mitte der Gesellschaft gerne verdrängt und die uns emotional so angreift, ist, dass die Zukunft nicht eine von ständig expandierendem Wohlstand, sondern eine der ständig expandierenden Katastrophen sein wird. Dass es diese Welt von «immer mehr und immer besser für alle» nicht geben wird.
Sie haben ein Buch über Ihre Einsicht geschrieben, dass wir die Transformation zur Postwachstumsgesellschaft nicht rechtzeitig schaffen, das Klima also nicht retten werden. Wann hatten Sie diese Einsicht?
Ich begann, das im April 2018 zu verstehen, als die ganze Stadt Berlin nach Feuer roch, weil in Brandenburg ein Wald brannte. Mir wurde da irgendwie körperlich klar: Wenn in Nordeuropa im Frühling Wälder brennen, ist das ein Zeichen des Kollapses. Neben der Einsicht, dass der Klimakollaps bereits begonnen hat, setzte sich bei mir aber in den letzten fünf Jahren noch eine weitere Einsicht durch, diejenige nämlich, dass der Klimaschutz als politisches Projekt gescheitert ist. In der Schweiz sieht man das ja gerade in einer totalen Radikalität. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat kürzlich geurteilt, das Land tue nicht genug für den Klimaschutz. Der Bundesrat hat darauf einfach mit einem «Fuck you» reagiert. «Finden wir blöd. Wir machen nichts.» Wir müssen nicht nur einsehen, dass das Klima bereits kollabiert. Wir müssen als Gesellschaft auch verstehen, dass wir bei der Verhinderung gescheitert sind. Nur dann verstehen wir, weshalb die Gesellschaften in Europa oder in den USA so irrational auf die Klimabewegung und ihre Forderungen reagieren.
Ihre Kernthese lautet: Das Verdrängen der Klimakrise führt zu einer «Arschlochisierung» der Gesellschaft. Oder wie Sie auch sagen: ins «Arschlochozän». Erklären Sie uns das bitte.
Die europäischen Gesellschaften der Nachkriegsära lebten lange in einer eingebildeten Ponyhofwelt. Ich komme aus dem Land der Täter:innen des Nationalsozialismus. Aber witzigerweise hat sich die Bundesrepublik spätestens nach 1968 eingeredet, dass jetzt alle Nazis weg und wir plötzlich dieses progressive, liberale Gleichstellungsland seien. Ein Champion bei den Menschenrechten, obwohl wir eine total ausbeuterische, neoimperiale Wirtschafts- und Ressourcenpolitik betrieben. Klimavorreiter, obwohl Deutschland in der Realität ein Vorreiter bei fossil betriebenen Autos ist. Im Überfluss liess es sich leicht mit solchen progressiven Selbstlügen leben. Dann kam Mitte der achtziger, Anfang der neunziger Jahre das Klimathema auf. Unsere Gesellschaften sagten: Ja, wir kümmern uns darum, auch weil wir verstanden haben, dass wir den anderen die Welt weggefressen haben. Klimaschutz war sozusagen die moralische Anforderung an unsere Gesellschaften. Und eine Zeit lang hat man tatsächlich darüber nachgedacht, etwas zu machen, es gab ein paar Klimagesetze, ein paar Debatten, aber im Kern haben wir in den letzten Jahren festgestellt, dass Klimaschutz zu anstrengend ist.
Er würde uns zu viel kosten.
Vor allem würde er unsere relativ bequeme Realität verändern. Und das wollen wir nicht. Und deswegen schämen wir uns jetzt. Die meisten Menschen verdrängen diese Gefühle, weil sie sehr unangenehm sind. Das erklärt so ein bisschen die total seltsame, teils sehr brutale Reaktion auf die Letzte Generation oder auf Extinction Rebellion. Über rechte Terrorist:innen regt man sich nicht so auf wie über die Klimakleber:innen. Und das liegt nicht nur daran, dass die Leute zu spät zur Arbeit kommen. Die Letzte Generation wollte unser Gewissen sein. Aber die Leute in den Autos haben gesagt: «I get it, aber ich will darüber nicht nachdenken, ich will mich damit nicht auseinandersetzen.» Freud nennt es die «Wiederkehr des Verdrängten».
Nach dem Sieg von Donald Trump analysierten viele Linke, er habe wegen der Inflation gewonnen, die Demokratische Partei habe die Wirtschaft nicht genug zum Wahlkampfthema gemacht. Sie hingegen sagen: Trump und andere Rechte machten vielen Wähler:innen schlicht ein gutes Angebot.
Womit wir bei der «Arschlochisierung» wären. Wenn ich mich so verhalte, dass das nicht mit meinen Werten übereinstimmt, habe ich zwei Optionen: Ich kann mein Verhalten verändern, aber das ist anstrengend, oder ich kann einfach meine Werte verändern, sodass ich mich nicht mehr schlecht fühle. Das ist genau das, was Trump so attraktiv macht. Er befreit die Leute von ihrer Scham, indem er sagt: Seid ruhig Arschlöcher. Auch in Europa feiert die Arschlochgesellschaft gerade ihr Coming-out. Wir scheissen auf den Rest der Welt, fahren mit Tempo 180 schnitzelessend durch die Fussgängerzone. Wir schämen uns nicht mehr dafür, dass Europa halt dieser Arschlochkontinent ist, der seine Privilegien verteidigt, der allen anderen alles wegnimmt, der die Mauern hochzieht, wenn Menschen hier Schutz suchen, einfach nur, weil sie anderswo nicht mehr leben können, weil wir auf ihre Kosten hier so reich geworden sind. Diese Zusammenhänge stressen nur, wenn man irgendwie noch den humanistischen Wertekanon ernst nimmt. Wenn man sagt: Es ist deren Schuld und mögen die doch verrecken, ist das Leben leichter. Natürlich leiden in den USA die Menschen unter der Inflation. Aber es ist einfach keine zulängliche Erklärung zu sagen: Wegen der hohen Preise haben wir den Faschisten gewählt.
Sie sagen, klassischer Klimakampf bringe nun nichts mehr. Stattdessen rufen Sie zum solidarischen Preppen auf. Was heisst das?
Das kann vieles heissen. Es geht darum, sich auf mögliche Krisensituationen in einer unsicher werdenden Welt vorzubereiten. Ich bin HIV-positiv. Anfang Jahr gab es plötzlich Lieferschwierigkeiten bei meinem überlebenswichtigen Medikament. Da können wir zum Beispiel «Buyers Clubs» gründen, um die solidarische Verteilung von Medikamenten zu sichern. Was das Klima angeht, plädiere ich für ganz basale, praktische Hilfestellungen über solidarische Netzwerke. Man kann in seiner Stadt schauen, was die wahrscheinlichste Auswirkung der Klimakrise ist. In Berlin ist das zum Beispiel die Hitze. Man könnte sich also nachbarschaftlich um die vertrocknenden Bäume in der Strasse kümmern, jeder adoptiert einen. Starke Hitzewellen treffen bekanntlich die Alten, Armen, Schwachen am meisten. Wir können also mit der Bezirksregierung zusammenarbeiten und schauen, wie wir auch alte Leute erreichen, die im fünften Stock im Altbau wohnen. Das klingt jetzt erst einmal sehr kleinteilig. Aber es geht mir um praktische Kollapspolitiken der Solidarität.
Aber wenn sich jetzt auch Linke einfach in ihre solidarischen Bunker zurückziehen, ist das nicht ein Stück weit zynisch?
Man kann sagen, es ist zynisch, weil es die globale Gerechtigkeitsperspektive aufgibt. Aber wir reden schon lange darüber, und es hilft nicht, wenn wir keinen realpolitischen Hebel haben, globale Gerechtigkeitspolitiken durchzusetzen. Stattdessen können wir unsere begrenzten Handlungspotenziale ernst nehmen und fragen: Wie setzen wir die rational ein? Natürlich müssen wir hier gleichzeitig weiter antifaschistisch zusammenstehen und gegen rechte Regierungen kämpfen – oder gegen Autobahnen.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie Sie das Scheitern des Klimakampfs in eine tiefe Zukunftsdepression gestürzt habe. Wie viel Zukunftshoffnung steckt denn nun noch in dieser Idee des solidarischen Preppens?
Die Zukunft wird dunkler. Ich kann jetzt hier keine Geschichte erzählen, die das ignoriert. Meine neue Hoffnung ist nicht mehr so glitzernd und hell wie die auf den globalen Queerkommunismus. Aber auch in einer sich ständig verschlechternden Welt haben wir immer noch die Fähigkeit, Räume für gutes Leben herzustellen. Und wenn alles gut läuft, können wir diese Räume erweitern und uns mit anderen Räumen vernetzen. Das ist für mich eine reale Hoffnung. Ich habe dazu ein etwas absurdes Bild: Ich lebe in Berlin, und Brandenburg rundherum ist ziemlich reaktionär. Wenn ich mir nun vorstelle, dass die faschistischen Horden kommen und unser Berlin übernehmen, dann stelle ich mir vor, wie in den Katakomben der Stadt ein paar von uns queeren Antifakämpfer:innen den letzten queeren Club der Welt eröffnen. Das mag jetzt absurd klingen, weil es so klein gedacht ist, aber es geht um gutes Leben, für eine Stunde oder einen Tag. Das war der Glaube, der mir verloren gegangen war. Nicht nur der Glaube an die Zukunft, sondern der Glaube an die Bewegung, die die Welt besser machen kann. Aber es kann immer weitergehen, weil es nie so scheisse ist, dass man nicht mehr dafür arbeiten kann, dass es weniger scheisse ist.
Wie schlimm es wird, darauf haben wir immer noch Einfluss. Muss also die Hoffnung nicht weiter darin liegen, dass wir Leute für eine Postwachstumsperspektive gewinnen können?
Sicher. Aber unsere Gesellschaften sind derzeit an einem Punkt, wo sie nach dreissig, vierzig Jahren Selbstüberforderung erst einmal sagen: Jetzt sind wir mal Arschlöcher. Das ist ein richtiges Befreiungsgefühl. Wir müssen realistisch davon ausgehen, dass humanistische Positionen im globalen Norden derzeit nicht mehrheitsfähig sind. Linke Politik speist sich ja im Grunde genommen aus dem Verständnis, dass Menschen solidarisch sein können. Das haben in vierzig Jahren Neoliberalismus viele Leute vergessen. Und wir müssen dieses Gefühl nun wiederherstellen. Wir müssen die netten Menschen sein, die in der Katastrophe mit allen zusammenarbeiten. Katastrophen sind unglaublich wuchtige politische Momente, da gibt es einiges an strategischer Handlungsmöglichkeit. Man sieht das derzeit etwa in Valencia, wo 10 000 Freiwillige im Katastrophengebiet aufräumen. Im Grunde will ich aus solchen Erfahrungen eine neue linke Politik aufbauen. Ist das nun wieder sehr optimistisch? Vielleicht. Aber ich glaube, die Zusammenhänge sind schon richtig. Wir erleben die Welt zwar katastrophal, aber auch solidarisch. Das müssen die Bausteine der neuen linken Bewegung sein.