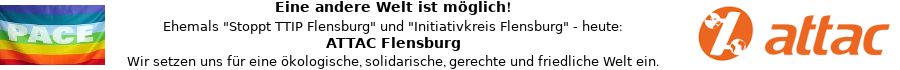Anbei die letzte China-Materialsammlung, vorwiegend aus unseren internen Rundmails:
- zum Webinar-Referenten Ingar Solty 2020 in einer Debatte (Werners mail am 03.01.):
https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/linke-positionierung-zu-china/
- Morten Text-Auszug zur BRI aus dem Buch "Beat Schneider - Chinas langer Marsch in die Moderne" - auf Anforderung - Mail an mich);
- Gerds "interessante China-Präsentation von Attac-München":
https://www.attac-muenchen.org/fileadmin/user_upload/Gruppen/Muenchen/Palaver/2023-02-27_China-Foliensatz.pdf
- Wemheuer u.a. erklären sich zu ihrem neuen Buch: - https://www.youtube.com/watch?v=n3GIVzC4rb4
"... das ist das erste Video zu unserem Buch Vielleicht werden noch weitere Diskussionen mit anderen Themen aus den Kapiteln folgen. Die Schwerpunkte lagen auf der europäischen Außenpolitik und ihrer Haltung zu China sowie der digitalen Plattform-Ökonomie und chinesischen Arbeitskämpfen. Zudem haben wir über den Zusammenhang zwischen der Verschärfung des sino-amerikanischen Konflikts und der autoritären Wende in China diskutiert.
Es wird eine Diskussion geführt zur Vorstellung des Buches: Daniel Fuchs, Sascha Klotzbücher, Andrea Riemenschnitter, Lena Springer, Felix Wemheuer (Hg.): Die Zukunft mit China denken (Wien: Mandelbaum Verlag, 2023) https://www.mandelbaum.at/buecher/daniel-fuchs-sascha-klotzbuecher-andrea-riemenschnitter-lena-springer-felix-wemheuer/die-zukunft-mit-china-denken/
Die Schwerpunkte lagen auf der europäischen Außenpolitik und ihrer Haltung zu China sowie der digitalen Plattform-Ökonomie und chinesischen Arbeitskämpfen. Es diskutierten am 5.Januar 2024: Prof. Dr. Susanne Weiglein-Schwiedrzik war von 2002 bis 2020 Professorin für Sinologie an der Universität Wien, wo sie zwischen 2011 und 2015 auch als Vizerektorin für Forschung und Nachwuchsförderung tätig war. Seit 2022 ist sie Mitglied des Akademierats der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Daniel Fuchs ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat in Wien und Tianjin Sinologie und Politikwissenschaft studiert und an der School of Oriental and African Studies (Universität London) zu Arbeitskämpfen von WanderarbeiterInnen in Südwestchina promoviert. Felix Wemheuer ist Professor für Moderne China-Studien an der Universität zu Köln. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Sozialgeschichte Chinas des 20.Jahrhunderts mit Hinblick auf das ländliche China, Klassen- und Geschlechterverhältnisse und ethnische Minderheiten, die Hungersnot infolge des »Großen Sprungs nach vorn« (1958–1961) sowie die Kulturrevolution.
- für die Zeitung "junge Welt" schreibt Marc Püschel kritisch über China: https://www.jungewelt.de/artikel/466468.china-am-scheideweg.html
- weiteres Material anhand unser aller "brennenden Fragen / Themen / Vorbehalte o.ä." zum Thema China diskutierten wir mit dem Textvorschlag:
Beat Schneider - Chinas langer Marsch in die Moderne
Russland, China und der Westen
Papyrossa, 333 Seiten, br., 22,90 € (erschienen im Dezember 2022) - ISBN 978-3-89438-792-1
Beat Schneider, *1946, ist emeritierter Professor. Er lehrte an der Hochschule der Künste Bern (HKB) und ist einer sozialgeschichtlich ausgerichteten Kultur- und Kunstgeschichte verpflichtet. Zahlreiche Bücher zur Kultur-, Kunst- und Design-Geschichte.Inhaltsverzeichnis hier
Leseprobe hier
Bahnexperte Arno Luik äußert sich im Gespräch mit den Deutschen Wirtschaftsnachrichten zu den jüngsten Streiks im Bahnverkehr. Er geht mit dem Management und dem aktuellen Vorstand hart ins Gericht: Die Bahnkrise sei hausgemacht und schade dem Industriestandort Deutschland.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wieder einmal hat die GDL gestreikt - und der Bahnstreik könnte in ein paar Wochen weitergehen. Haben Sie dafür Verständnis?
Arno Luik: Ja, klar. Denn die Forderungen der GDL sind nicht abwegig oder unverschämt – sie sind zeitgemäß, insbesondere ihre Hauptforderung: die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche. Die Bahn ist zu 100 Prozent im Staatsbesitz, und ich finde, ein Staatsbetrieb sollte ein Vorbild sein, was sein Verhalten gegenüber seinen Mitarbeitern betrifft. Und so ist es eine Frechheit der Bahnchefs, einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 32 Monaten durchsetzen zu wollen: Die Zeiten sind überaus unsicher, ökonomische Verwerfungen jederzeit möglich, eine Rekordinflation nicht unwahrscheinlich. In einer solchen Situation seinen Angestellten einen Tarifvertrag über zweieinhalb Jahre anzubieten – das ist eine Provokation.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Ihrer Meinung nach geht der Staatsbetrieb Bahn nicht anständig mit seinen Mitarbeitern um?
Arno Luik: Dieses Gefühl habe ich in der Tat. Ich kenne Lokomotivführer, die schieben – angehäuft in einem Jahr – 400 bis 600 Überstunden vor sich her. Da ist ein ordentliches Familienleben kaum möglich. Die 35-Stunden-Woche gibt es bei der IG-Metall schon seit drei Jahrzehnten, für viele Betriebe ist dieses Modell längst das Normalste der Welt. Und genauso müsste es für einen Staatskonzern sein. Wer zufrieden ist, streikt nicht. Streik ist Notwehr. Und noch etwas: Wenn man ins Ausland schaut, nach Österreich, Luxemburg, in die Schweiz, zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen der jeweiligen Bahnführung und den Angestellten gut funktioniert. Die dortigen Bahnmitarbeiter werden auch deutlich besser entlohnt, sie haben ordentliche Arbeitszeiten, nach Schichtdiensten geregelte Ruhezeiten. Warum geht das nicht in Deutschland? Hierzulande kommt ein Lokführer im Schnitt auf 35.000 bis 45.000 Eu ro, in Österreich auf 52.000 Euro, in der Schweiz – bei höheren Lebenshaltungskosten – auf bis zu 104.000 Franken (etwa 110.000 Euro). Und so kommt es, dass derzeit über 100 bei der Deutschen Bahn ausgebildete Lokführer in der Schweiz arbeiten.
Martin Seiler, Personalvorstand bei der Bahn, klagt, dass er zu wenige Lokführer hat. Vielleicht hat das etwas mit ihm zu tun, mit seiner Personalführung, mit den Löhnen, die er zahlt? GDL-Chef Claus Weselsky wird ja oft als der böse Bube dargestellt. Aber er ist kein Klassenkämpfer. Er ist Mitglied der CDU. Weselsky hat mit rund 20 Privatbahnen Tarifverträge abgeschlossen – ohne, dass die Öffentlichkeit etwas davon mitbekommen hätte. Es ging ratzfatz. Da war der Wille zum Ausgleich da. Überall gab es Einstiege in die 35-Stunden-Woche, geregelte Arbeitszeiten wurden vereinbart, Ruhezeiten nach Schichtarbeit. Man sieht: Weselsky ist nicht auf Krawall gebürstet.
Die Bahn ist faktisch pleite
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Ist die Bahn nicht knapp bei Kasse? Kann sie sich derartige Lohnerhöhungen überhaupt leisten?
Arno Luik: Die Bahn ist knapp bei Kasse? Knapp? Sie ist – obwohl der deutsche Steuerzahler dieses Unternehmen Jahr für Jahr mit zig Milliarden subventioniert – so hochverschuldet, dass es den Bundeshaushalt gefährdet. Warum? Das hat sehr, sehr viel mit dem Unvermögen des Bahnmanagements zu tun. Und nun muss man die Worte Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit einführen: Die neun Vorstände der Bahn bekommen neun Millionen Euro an Boni ausgezahlt. Ihre Grundgehälter sind riesig.
Personalvorstand Martin Seiler kommt alles in allem auf 1,3 Millionen Euro, dazu erhält er noch einen dicken Bonus. Für was? Dass er Tarifangebote macht, die keine Gewerkschaft akzeptieren kann? Dass die Bahn zu wenig Mitarbeiter hat? Bahn-Chef Richard Lutz hat ein Grundgehalt, das ungefähr dreimal so hoch ist wie das des Bundeskanzlers, dazu noch Boni in Höhe von zwei Millionen Euro. Für was bloß? Dass unter seiner Regentschaft die Bahn mit 35 Milliarden Euro in den Miesen ist, also: faktisch pleite. Die Eisenbahner – und viele, viele Bundesbürger – fragen sich: Wie kann es sein, dass diese Bahnchefs, die den Laden an die Wand gefahren haben, Stichworte sind Verspätungen, Zugausfälle, notorische Unzuverlässigkeit, dass diese Manager für ihr Versagen noch üppig belohnt werden? Das lässt sich niemandem vermitteln.
So entsteht Staatsverdrossenheit. So wächst dieses gefährliche Gefühl: „die da oben“ sahnen ab, das Gefühl: Es ist nicht gerecht, was hier abläuft. Auch die Bahn-Mitarbeiter sehen natürlich die absurd hohen Gehälter ihrer Vorstände, die völlig durchgeknallten und nicht zu rechtfertigenden Boni – das schafft Frust und Empörung gerade bei jenen, die diesen immer mehr zerfallenden Laden am Laufen halten. Gestresste Mitarbeiter, die tagtäglich die Aggressionen unzufriedener Kunden ertragen müssen – und das zu Löhnen, für die ihre Chefs im Berliner Bahnturm sich nicht aus ihren Ledersesseln erheben würden. Dieses Gefühl von Ungerechtigkeit stärkt die Streikbereitschaft.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Woran liegt es eigentlich, dass die Bahn so massiv mit Zugausfällen und Verspätungen zu kämpfen hat?
Arno Luik: Um es ganz klar zu sagen: An der Unfähigkeit des Bahnmanagements. Weselsky bezeichnet den Bahn-Vorstand als „Luschen“, „Versager“, „Duckmäuser“, als „Nieten in Nadelstreifen“. Nicht meine Worte. „Nieten in Nadelstreifen“ stimmt nicht, weil die Bahnchefs heute keine Nadelstreifen mehr tragen. Aber der Rest von Weselskys Einschätzung ist leider und unseligerweise durch Fakten gedeckt. Die Bahn befindet sich in einem desolaten Zustand. Und die Verantwortlichen dafür, ich wiederhole mich, sitzen in der Unternehmenszentrale in Berlin.
Mal grundsätzlich gesagt: Seit gut drei Jahrzehnten sind die Bahnchefs keine Bahnprofis. Sie haben das Handwerk nicht von der Pike auf gelernt – doch das Geschäft Bahnfahren ist eine hochkomplizierte Materie. An der Spitze waren und sind Menschen, die merkwürdigerweise aus Konkurrenzfirmen zum potenziell ökologischen Verkehrsunternehmen Bahn kamen: Dürr – Autoindustrie; Mehdorn – Autoindustrie; Grube – Autoindustrie, Luftfahrt. Alle Chefs, seit der Bahnreform 1994, waren zu Beginn ihrer Bahnkarriere Bahn-Azubis. Überbezahlte Bahn-Azubis. Kann das gutgehen? Wenn es die Politik ernst meint mit der angestrebten Verkehrswende, dann müssen wirkliche Bahnprofis an die Spitze dieses so wichtigen Unternehmens, wie in Österreich oder der Schweiz
Nun heißt es, Richard Lutz sei ja so ein Profi, er sei ein Bahner. Aber das stimmt so nicht. Lutz ist zwar schon lange bei der Bahn – als Finanzkontrolleur, als Finanzchef. Und er hat all die desaströsen Sparprogramme seiner Chefs, die die Bahn in diesen erbärmlichen Zustand brachten, abgesegnet. Es ist wirklich traurig. Wie schlecht es um die Bahn steht, merkt jeder Bürger, wenn er Zug fährt. Die Pünktlichkeitsquote liegt derzeit bei knapp 60 Prozent. Peinlich. Wobei diese Quote überhaupt nichts aussagt. Denn „ein Zug, der nicht losfährt, kann nun mal nicht zu spät ankommen“, sagt Bahnchef Lutz. Also tauchen ausgefallene Züge in der Statistik nicht auf. In der Logik des Bahnchefs, wäre eine perfekte Bahn also eine Bahn, bei der gar kein Zug mehr fährt.
2018 fielen mehr als 140.000 Züge komplett aus. Nur leicht übertrieben gesagt: Der einzige Zug, der in Deutschland pünktlich losfährt, ist der Rosenmontagszug in Mainz. Es ist wirklich tragisch: Die Bahn, die mal perfekt wie ein Uhrwerk funktionierte, Vorbild für fast alle Bahnen dieser Welt war, sie wurde in kurzer Zeit, in rund 30 Jahren, seit der Bahnreform, als das Unternehmen sexy für die Börse gemacht werden sollte und zur Aktiengesellschaft wurde, kaputtgespart und nachhaltig ruiniert.
„Fatale, weltumspannende Expansion“
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: In anderen Ländern wie der Schweiz, Österreich oder Italien funktioniert es doch auch.
Arno Luik: Dort sind auch Menschen an der Spitze der Staatsbahnen, die ihr Handwerk beherrschen. Und, ganz wichtig, sie kümmern sich um ihre Bahnen – und sonst um nichts. Ein sehr wichtiger Grund, weshalb diese Deutsche Bahn kaum mehr funktioniert, ist die Tatsache, dass die Deutsche Bahn keine Deutsche Bahn mehr ist. Sie ist bloß noch ein Anhängsel in einem global agierenden Imperium, über dem die Sonne nicht untergeht.
2022 generierte die Bahn gut 50 Prozent ihrer Umsätze im Ausland. Viel Geld wird da bewegt, der Gewinn aber ist gering, die Konkurrenz beinhart. Mehr als zehn Milliarden Euro gingen für diese Auslandseinsätze drauf, Investitionen, die sich nicht amortisieren. Investitionen, die hier fehlten. Investitionen, von denen der Bürger hier nichts hat. Anstatt sich um die Kundschaft hier zu kümmern, kümmert sich diese Bahn um alles Mögliche und Unmögliche in aller Welt. Viele Seiten könnte ich nun mit Namen füllen, die vielleicht nicht einmal die Damen und Herren in ihrem Berliner Bahnhochhaus kennen: Malawi, Curacao, Mongolei, Moldawien, Ghana, Indonesien – in 140 Ländern war 2022 die Deutsche Bahn AG mit Bussen, Flugzeugen, Schiffen, PKWs, LKWs, Krankenwagen, Elektroautos unterwegs. Mit rund 800 Gesellschaften, Firmen und Firmenbeteiligungen agiert sie rund um den Globus. Für wen? Wozu?
Vor gut 20 Jahren hat Bahnchef Hartmut Mehdorn diese für den Bürger hierzulande so überaus fatale, weltumspannende Expansion begründet, sie ist der Grund, weshalb die Bahn hierzulande so kläglich dahinrumpelt: Wer in Katar das Streckennetz ausbaut, in Dubai mit Lufttaxis experimentiert, wer Marktführer im Schiffsverkehr zwischen China und den USA ist, wer einer der größten Luftfrachtunternehmer der Welt ist, hat der noch Lust und Zeit, Züge auf der Schwäbischen Alb, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen pünktlich fahren zu lassen? Kümmert der sich um marode Brücken, die im ganzen Land die ICEs zum Langsamfahren zwingen?
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Warum wird denn die Bahn von der Politik so stiefmütterlich behandelt? Und gerade von Seiten der Ampel-Regierung, die sich doch die Energiewende auf die Fahnen geschrieben hat?
Arno Luik: Deutschland ist ein Auto-Land. Franz Münterfering, der ja in seiner langen SPD-Politkarriere auch mal Verkehrsminister war, sagte mal: „Die Bahn ist das Resteverkehrsmittel für jene, die sich ein Auto nicht leisten können.” Vorfahrt Auto. Dieses Bahnversagen ist natürlich ein Staatsversagen. Schuldig: die Herren und Damen im Bundeskanzleramt und ihre Verkehrsminister. Sie ließen es zu, dass der größte deutsche Staatskonzern ein Staat im Staat wurde. Und zu einer Geldvernichtungsmaschine. Sogar dem Verkehrsminister ist jetzt klar: „So wie es ist, kann es nicht bleiben.“ Das sagt er, aber: Wird es besser? Nein! Wird es endlich gut mit dieser Bahn? Die meisten der aktuellen Verheißungen sind ohne Bezug zur Realität. Seit 1994, seit der staatlich organisierte Zerfall mit der Bahnreform begann, die als Ziel Börsengang und Privatisierung hatte, wurde gespart an Menschen, Material, Re paraturen, Investitionen. Heute fehlt es an allem: an Gleisen, an Land für Gleise, an Lokomotiven, an Zügen, an Personal. Und: an Knowhow.
Allen Beteuerungen der Regierenden zum Trotz: Das Thema Bahn ist den Regierenden nicht wirklich wichtig – das zeigt ein Blick in den Koalitionsvertrag. Nicht mal eine Seite umfasst dort das Thema Zugverkehr. Diese Passage ist eine lose Aneinanderreihung all der Verheißungen, die man seit Jahren hört, also dies: Reaktivierung von Strecken, Elektrifizierung, Stilllegungen vermeiden, Kapazitätserweiterung. Klimafreundliches wird gewunden formuliert und sofort relativiert: „Bei neuen Gewerbe- und Industriegebieten soll die Schienenanbindung verpflichtend geprüft werden.”
Zieht trotz alledem nun – weil es so dringend sein müsste – Vernunft ein in die Verkehrspolitik? Ja, sagen nun fast alle Politiker, wir haben dazu gelernt, wir geben der Bahn in den kommenden Jahren viel Geld, richtig viel Geld: 60, 70, ja, 90, vielleicht sogar 150 Milliarden Euro Steuergeld! Darf ich mich als Bürger und Bahnfahrer über diese astronomischen Summen freuen? Nein, unglücklicherweise nicht. Gerade wenn ich mir Sorgen um das Klima mache. Die einzig gute Idee, die Ex-Bahnchef Grube hatte, war es, die ICEs nicht schneller als Tempo 250 fahren zu lassen. Aber jetzt will man wieder Strecken bauen für Tempo 330. Das ist Ökofrevel. Unsummen sollen in unökologischen und unökonomischen Großbetonprojekten versenkt werden, wieder und immer noch in Stuttgart 21, in Münchens zweiter Stammstrecke, in einen Tiefbahnhof unter Frankfurt, in die Verlegung des Bahnhofs Hamburg-Altona nach Diebsteich, in eine Neubaustrecke vo n Dresden nach Prag samt riesigem Tunnel. Was da geschehen soll, ist Klimakill pur. Der Bau eines einzigen Tunnelkilometers setzt so viel CO2 frei wie 26.000 Autos, die je 13.000 Kilometer, des Bundesbürgers Durchschnittsstrecke, fahren.
Dramatische Unvernunft, allüberall: In Mexiko beteiligt sich der Staatskonzern über eine Tochter an dem gigantischen Bahnprojekt „Tren Maya“, einer Trasse von über 1.500 Kilometern – auch quer durch Regenwälder. Dort lebende Nachfahren der Maya kämpfen gegen den Bau, sie fürchten, dass der Zug das sensible Ökosystem gefährdet, ihre Lebensgrundlagen zerstört und sie dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Das ist dieselbe Bahn, die sich hierzulande als Zeichen der Umweltliebe grüne Streifen auf die ICEs klebt.
Diese Bahn, die hierzulande nicht in der Lage ist, ihre Strecken zeitgemäß zu elektrifizieren, vermeldet voller Stolz, dass sie „das größte Bahnprojekt in der Geschichte Ägyptens und mit 2.000 Streckenkilometern sechstgrößte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt übernehmen“ wird. Was soll dieser Auslandseinsatz? Angesichts des erbärmlichen Zustands der Bahn hierzulande? Hier sind gerade mal 61 Prozent der Strecken elektrifiziert. Eine Schande für dieses Industrieland. Diese Bahn ist eine Zumutung. Und ich staune, mit welch buddhistischer Geduld die Bürger das alles hinnehmen: diese Verspätungen, diese Zugausfälle, diese strukturelle Unzuverlässigkeit, den offensichtlichen Zerfall dieses so wichtigen Verkehrsmittels.
Deutsche Bahn zieht sich aus dem Güterverkehr zurück
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie ist eigentlich die Situation in den USA? Auch da scheint ja die Bahn, zumindest was den Personenverkehr anbelangt, nicht beliebt zu sein.
Arno Luik: In den USA funktioniert der Personenverkehr zwischen den wichtigen Metropolen, etwa zwischen New York und Washington, recht gut. Also für die Businessleute, die Politiker, die Betuchten. Ansonsten hat sich die Bahn in Sachen Personenverkehr nahezu komplett aus allen Städten verabschiedet. Es ist ja häufig so, dass sich die Dinge, die in den USA geschehen, sich nach einigen Jahren in Deutschland wiederholen. Bei uns fließt das versprochene Geld, weit über 90 Prozent, wie gesagt in Großprojekte und in die ICE-Bolzstrecken zwischen den Metropolen. Primär für die Businessleute also, gerade mal 140 Millionen Bürger sind im Fernverkehr unterwegs. Fast kein Geld aber fließt in den Nah- und Regionalverkehr. Aber dort sind fast drei Milliarden Menschen jährlich unterwegs, für die wird so gut wie nichts getan. Auch das schafft Staatsverdrossenheit – gerade auf dem Land. Die Menschen dort fü hlen sich abgehängt, vernachlässigt.
Was in den USA noch passiert, ist bemerkenswert: Rund 40 Prozent der Güter werden dort mit der Bahn befördert. Pro Kopf transportieren die US-Güterzüge zehnmal so viel wie im Rest der Welt. Das hat Gründe: Die Transportkosten in den USA sind auf der Schiene deutlich günstiger als auf der Straße. In den USA gibt es für die Züge, auch wenn sie die Rocky Mountains überfahren, kaum Tunnel, die die Kosten in die Höhe schießen lassen. Auch sind die Güterzüge dort viel länger: bis zu 3 660 Meter. In Europa sind sie nur im Ausnahmefall länger als 700 Meter, und auch die zulässige Achslast ist in den USA um 60 Prozent höher als in Europa. Folge: Ein US-Güterzug schleppt die Last von sieben europäischen Güterzügen. Und noch etwas: In den USA transportieren die Züge häufig Container doppelstöckig – also zehnmal so viele Container wie auf den einstöckigen Zügen in Europa. Die US-Verhältnisse lassen sich nicht nach Europa übertragen. Aber so kümmerlich wie es um den Güterzugverkehr in Deutschland steht, das muss nicht sein. Das ist ein geplantes Desaster der Politik: Der Kotau vor der Autoindustrie.
Die Deutsche Bahn, so muss man konstatieren, zieht sich aus dem Güterverkehr zurück bzw. hat sich schon längst, was den Gütertransport vor allem über kurze und mittlere Distanzen anbelangt, praktisch komplett abgemeldet. Ihr Anteil an der Güterbeförderung in Deutschland liegt bei gerade mal 16 Prozent – und ist ein Minusgeschäft. Das ist peinlich. Vor allem dann, wenn man ins Ausland schaut. Auf Schweizer Autobahnen sieht man kaum LKWs, die mit Containern beladen sind, man sieht dort überhaupt wenig LKWs. Wer wissen möchte, wie man mit Gebühren eine ökologischere Verkehrspolitik erwirkt, muss an die Schweizer Grenze bei Lörrach. Dort wird die LKW-Fracht auf Züge umgeladen. Die Spediteure haben keine Lust, die Straßenmaut, die in der Schweiz dreimal so hoch ist wie in Deutschland, zu bezahlen. Und so kommt es, dass in der Schweiz über 35 Prozent des Güterverkehrs Zug fäh rt – mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Das eklatante Versagen der hochsubventionierten Bahn AG im Güterverkehr ist vor allem ein Managementfehler, den die Politik hinnimmt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Ihr Fazit? Ist die Deutsche Bahn noch zu retten?
Arno Luik: Ich halte diese Bahn für nicht mehr reparabel. Es ist sehr einfach, etwas zu zerstören, aber viel schwerer ist es, das Zerstörte zu reparieren. Wie sehr diese Bahn demoliert wurde, zeigt sich beispielhaft an ein paar Zahlen: Um auf den Standard der Schweiz zu kommen, müsste das Bahnnetz augenblicklich um 25.000 Kilometer erweitert werden – ein Ding der Unmöglichkeit. Wo früher Gleise und Rangierbahnhöfe waren, stehen heute Einkaufszentren, Büro- und Wohngebäude. Oder gar nichts, aber irgendetwas Unschönes wird schon noch kommen.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind über 100 Städte vom Fernverkehrsnetz abgehängt worden, Mittel- und Großstädte wie etwa Chemnitz (240.000 Einwohner), Potsdam (172.000), Krefeld (234.000), Heilbronn (122.000), Bremerhaven (114.000). Für Millionen Menschen wurde durch dieses Abkoppeln das Bahnfahren erschwert und unattraktiv. Noch etwas: Hatte die Bahn 1994 noch über 130.000 Weichen und Kreuzungen sind es heute um die 70.000. Aber jede rausgerissene Weiche heißt: weniger Überhol- und Ausweichmöglichkeiten. Heißt: Verspätungen. Heißt: Frust. Enttäuschung bei den Kunden. Gab es 1994 noch 12.000 Gleisanschlüsse für Industriebetriebe, sind es heute bloß noch knapp 2.000. Wie soll so eine ökologische Verkehrswende möglich sein?
Ein Letztes: Betrug die Netzlänge 1994 noch über 40.000 Kilometer, sind es heute bloß noch rund 33.000 Kilometer. Diesen Raubbau spüren die Wartenden an den Bahnsteigen, die Gestrandeten im Nirgendwo, die Verspäteten im ICE, vor dem ein Güterzug schleicht. Denn auf dem reduzierten Gleisangebot können gerade mal noch zwei Drittel der Züge ordentlich fahren. Für ein Drittel der Züge, klagen Disponenten der Bahn, also jene, die zunehmend verzweifelt versuchen, die Züge irgendwie noch fahren zu lassen, muss man irgendwelche Nischen finden, sie irgendwie hin- und herschieben. Pünktlichkeit ist strukturell auf unabsehbare Zeit nicht machbar. Fahrplan ade. Ein paar Jahre lang konnte man den schleichenden Verfall der Bahn kaschieren, schließlich war die Bahn vorher ein sehr robustes System. Früher bewunderte die Welt Deutschland für sein perfektes Bahnsystem. „Pünktlich wie die Eisenbahn“ war ein geflügeltes Wort. Heute ist das geflügelte Wort: „Schaden in der Oberleitung“. Jetzt steht die Bahn vor dem Kollaps. Ich fürchte, sie hat den Kipppunkt bereits überschritten. Jetzt kommen ja diese Generalsanierungen, mit denen alles gut werden soll. Solche oft monatelange Sperrungen von Hauptverkehrsstrecken – etwa bei einer der wichtigsten Strecken Europas: von Frankfurt nach Mannheim. Vollsperrungen wegen Sanierung: Das gab es früher nicht. Da wurde „unterm laufenden Rad“ repariert – meist vom Bahnfahrer unbemerkt. So ist das weltweit. Diese Generalsanierungen zeigen jedem Bürger, dass das Bahnmanagement unfähig ist, dass es in den vergangenen Jahren die Infrastruktur sträflich vernachlässigt hat. Diese Generalsanierungen sind fatal. Sie sind ein gigantisches Umerziehungsprogramm. Etwas verzweifelt formuliert: Bahnkunden werden zum Autofahrer gemacht.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sie klingen total pessimistisch.
Arno Luik: Ich bin fassungslos. Und traurig, weil etwas sehr Gutes unnötiger- und sträflicherweise total ramponiert wurde. Völlig ausgeschlossen ist es aber, diesen allgemeinen Zerfall der Bahn mit dem aktuellen Vorstand zu stoppen. Die Damen und Herren dort sind für den desolaten Zustand verantwortlich. Wie soll der Täter zum Retter werden? Brandstifter macht man doch auch nicht zu Feuerwehrkommandanten.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Herzlichen Dank für das Gespräch!
Info zur Person: Arno Luik, geb. 1955, war Reporter für Geo und den Berliner Tagesspiegel, Chefredakteur der taz, Vize-Chef der Münchner Abendzeitung und langjähriger Autor des Stern. Für seine Berichterstattung in Sachen Stuttgart 21 erhielt er 2010 den »Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen« der Journalistenvereinigung „Netzwerk Recherche“. 2015, bei der Anhörung des Deutschen Bundestags zum Thema »Offene Fragen zum Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 aufklären«, war Luik als Sachverständiger geladen. Sein Buch „Schaden in der Oberleitung – das geplante Desaster der Deutschen Bahn“ ist im Westend Verlag erschienen.
Gespräche von „Deutschlands führendem Interviewer“ (taz) sind in mehr als 25 Sprachen übersetzt worden; für sein Gespräch mit Inge und Walter Jens wurde Luik 2008 als „Kulturjournalist des Jahres“ ausgezeichnet. Seine besten Interviews hat er gerade veröffentlicht, der Titel des Gesprächbands ist ein Zitat von Angela Merkel: „Als die Mauer fiel, war ich in der Sauna“ (Westend, 2022, 287 Seiten, 24 Euro) Zuletzt erschien von ihm „Rauhnächte“ (Westend, 2023, 188 Seiten, 22 Euro). Nach seiner Krebsdiagnose im Spätsommer 2022schreibt Luik ein Tagebuch: Er notiert seinen Innenansichten, den Schrecken, die Albträume, seine Sehnsucht nach Leben – aber plötzlich geht es um viel mehr als das persönliche Drama: um diese zerrissene, malträtierte Welt. Die so schön sein könnte, wenn, zum Beispiel, die Regierenden nicht … &bdqu o;So aufwühlend geraten Bücher selten“ (Harald Welzer)
Liebe Attacis,
vom 27. bis 29. Oktober 2023 hat der Attac-Ratschlag in Hannover getagt.
Für alle, die keine Gelegenheit hatten, dabei zu sein, nachfolgend eine paar Infos dazu.
Gestartet hat der Ratschlag am Freitagabend mit einer spannenden Podiumsdiskussion Kulturkampf und Klimakrise: Mediale Berichterstattung und rechte Narrative mit der Autorin und Journalistin Sara Schurmann und Judith Amler aus dem Koordinierungskreis von Attac. Sara Schurmann hat sehr eindrücklich die vielfältigen Gründe dargelegt, die dazu führen, dass das Thema Klimakrise nicht angemessen in den Medien diskutiert wird. Judith Amler hat gezeigt, wie Rechtsextreme auch dieses Thema nutzen, um ihre menschenverachtende und unsoziale Agenda voranzubringen. In der lebendigen Debatte im Plenum ging es dann vor allem darum, was diese Erkenntnisse für Attac und die Forderung nach einer sozial-ökologischen Transformation bedeuten und wie wir unsere Kampagnen gestalten müssen, um damit in der Öffentlichkeit besser durchzudringen.
Der Samstagvormittag war geprägt von der Debatte um das Positionspapier aus dem Erneuerungsprozess. Nachdem die Moderationsgruppe den über zwei Jahre dauernden und breit in Attac geführten Diskussionsprozess kurz Revue passieren ließ, wurden in einer sehr solidarisch geführten Diskussion letzte Änderungsvorschläge verhandelt und abgestimmt. Am Ende fand das modifizierte Positionspapier eine sehr breite Zustimmung im Konsens. Es bildet jetzt die aktualisierte Grundlage für die inhaltliche Attac-Arbeit.
Am Samstagnachmittag standen die für 2024 geplanten Kampagnen im Mittelpunkt. Nach einer kurzen Darstellung des im Frühjahr 2023 gestarteten Kampagnenfindungsprozesses wurden die beiden daraus entstandenen Kampagnenvorschläge vorgestellt. Beim Kampagnenvorschlag Klimageld geht es um die Forderung nach der Einführung des Klimagelds. Es soll die unteren und mittleren Einkommen von den durch die CO2-Bepreisung steigenden Kosten für Klimaschutz entlasten und durch diesen sozialen Ausgleich auch die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen erhöhen. Beim Kampagnenvorschlag Lithiumabbau/Handelsverträge geht es darum, den schädlichen Lithiumabbau in der chilenischen Atacama-Wüste zu stoppen. Er würde durch das aktuell verhandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Chile weiter vorangetrieben. Beide Vorschläge stießen auf breite Zustimmung und sollen nun durch die eingerichteten Kampagnengruppen umgesetzt werden.
Am Sonntagmorgen wurden weitere inhaltlich Vorschläge diskutiert und dann der Haushaltsplan für 2024 vorgestellt und beschlossen. Aufgrund der angespannten Finanzsituation von Attac mussten einige Kürzungen vorgenommen werden. Daneben wurden Maßnahmen diskutiert, wie die Einnahmen gesteigert werden können, um die Arbeit des Netzwerks wieder auf eine stabile finanzielle Grundlage zu stellen.
In Kürze wird das Protokoll des Ratschlags und alle Beschlüsse auf der Ratschlagsseite zur Verfügung stehen.
Insgesamt war der Ratschlag von vielen guten politischen Debatten geprägt, die überwiegend solidarisch und wertschätzend geführt wurden. Nach einigen schwierigen und von teils verletzendem Streit geprägten Ratschlägen der Vergangenheit hat der in Hannover Mut gemacht, die Erneuerung des Projekts Attac fortzuführen.
Es grüßt
Die Ratschlags-VG
Christiane Kühnrich (sie/ihr) Eventkoordinatorin Attac Attac-Bundesbüro
Soziale Bewegungen sind heutzutage fast immer zerstritten. Warum ist das so, und wie kommen wir da raus? Ein Gastbeitrag.
Fabian Scheidler 24.06.2023
Die Zeiten sind verwirrend und die politische Obdachlosigkeit nimmt zu. In welches politische Spektrum würden Sie zum Beispiel jemanden einordnen, der sich Ihnen so vorstellt:
Ich bin für Verhandlungen im Ukrainekrieg, aber ich hege keine Sympathien für die russische Regierung.
Ich bin Anhänger der Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr, nicht aber der SPD.
Ich bin für einen entschlossenen und sozial gerechten ökologischen Umbau, aber kein Freund der Grünen Partei.
Ich halte viele der vergangenen Coronamaßnahmen, insbesondere den zweiten Lockdown und die 2G-Maßnahmen, für gesundheitspolitisch falsch und gesellschaftlich destruktiv, aber ich habe nicht die geringsten Sympathien für die AfD und andere rechte Gruppierungen.
Ich bin für Umverteilung von den Reichen zu den Armen, sehe aber bei der Linken-Partei nach ihrem Versagen in der Coronazeit keine politische Heimat.
Ich glaube, dass es eine neue politische Kraft in diesem Land braucht, betrachte aber eine Wagenknecht-Partei, die sich bei den Themen Migration und Klima rechts anbiedert, nicht als Lösung.
Haben Sie eine Vokabel für jemanden mit solchen Positionen? Nein? Ich auch nicht. Außer meinen eigenen Namen.
Ich könnte mit dieser Liste noch eine Weile weitermachen, nicht nur in Bezug auf Parteien, sondern auch auf Bewegungen und politische Milieus. Und je länger ich fortführe, desto kleiner würde die Insel, auf der ich stehe. Habe ich mich isoliert? Oder sind die anderen abtrünnig geworden? Stehen wir alle auf immer kleiner werdenden Inseln?
Und wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Als ich in den frühen 2000er-Jahren begann, mich politisch einzumischen, sah die politische Landschaft vollkommen anders aus. Auch nicht unbedingt schön, es war die Zeit nach dem 11. September, der Krieg gegen den Terror begann. Aber damals begann auch der Aufschwung der sogenannten globalisierungskritischen Bewegung in Europa, und es herrschte eine bemerkenswerte Aufbruchsstimmung. Auf dem Gründungskongress von Attac Deutschland in der Berliner TU etwa waren über 2000 Menschen: Friedensbewegte, Linke und Umweltaktivisten aus allen Generationen, von Alt-68ern, die am selben Ort schon den Vietnam- und den Tunix-Kongress organisiert hatten, bis zu 20-Jährigen, die sich erstmals politisch engagierten.
„Eine andere Welt ist möglich“
Fortan gab es fast jedes Jahr einen großen Kongress, und alle waren sie dabei: Jugendumweltbewegte und Sozialisten, die DGB-Jugend und Brot für die Welt, die Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, der BUND und Pro Asyl. Nicht alle konnten sich leiden, aber es wurde miteinander geredet, nicht selten auch gestritten, und an bestimmten Punkten gemeinsam gehandelt. Wir gingen 2003 gegen den Irakkrieg zu Hunderttausenden auf die Straße, wir fuhren gemeinsam zum Europäischen Sozialforum nach Paris, wo 50.000 Menschen über eine Welt jenseits von Krieg und zerstörerischem Kapitalismus diskutierten. Beim Weltsozialforum in Porto Alegre, Brasilien, waren es sogar mehr als 100.000. Die Slogans lauteten: „Eine andere Welt ist möglich“, „Die Welt ist keine Ware“. Dazu das zapatistische Motto „Fragend gehen wir voran“.
Auch in kleinen Strukturen war Vielfalt ein bestimmendes Prinzip. In einer Arbeitsgruppe, in der ich lange mitarbeitete, wirkten SPD-Abweichler, die gegen die Agenda 2010 aufbegehrten, ökologische Wachstumskritiker, Feministen, Antiimperialisten und Anarchisten zusammen. Ein Veteran der 68er gab die Devise aus: In der Sache hart argumentieren, aber mit einer Haltung buddhistischer Freundlichkeit. Das taten wir auch, planten Aktionen und kochten gemeinsam. Durch das breite Spektrum an Positionen habe ich in dieser Zeit mehr über Politik gelernt als je an einer Universität. Ich lernte, ein und dieselbe Frage aus mehreren Perspektiven zu betrachten, inhaltlich und strategisch. Ich lernte zuzuhören, bevor ich urteilte.
Ökologische Außenpolitik ist gewaltfreie Politik, oder?
Diese Arbeitsgruppe sollte später eine der Keimzellen für eine ganze Reihe von wichtigen Initiativen werden, darunter der Berliner Wassertisch, der mithilfe eines Volksentscheids die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe durchgesetzt hat. Und eines der Geheimnisse des Erfolges war: Pluralität.
Zwanzig Jahre später ist von alledem kaum etwas übriggeblieben. Die globalisierungskritische Bewegung und der Konvergenzprozess der Sozialforen sind weitgehend Geschichte. Wenn ich sie bei Veranstaltungen erwähne, weiß kein Mensch unter 40, dass es diese außerordentliche weltweite Zusammenarbeit überhaupt je gegeben hat. So kurz ist das Gedächtnis der Linken.
Insbesondere Umwelt- und Friedensbewegung sind heute tief gespalten. Dabei waren sie über Jahrzehnte eng verbunden, schon lange vor der globalisierungskritischen Zeit. Greenpeace etwa ist aus der Friedensbewegung hervorgegangen, es wurde 1971 gegen Atombombentests in Alaska gegründet. In der Folgezeit ging es um die Rettung der Wale und den Widerstand gegen Militarisierung. Die Gründung der Grünen führte in Deutschland diese Bewegungen in einer Partei zusammen. Im Grundsatzprogramm von 1980 hieß es: „Ökologische Außenpolitik ist gewaltfreie Politik. (…) Gewaltfreiheit bedeutet nicht Kapitulation, sondern Sicherung des Friedens und des Lebens mit politischen Mitteln statt mit militärischen. (…) Der Ausbau einer am Leitwert Frieden ausgerichteten Zivilmacht muss mit der sofort beginnenden Auflösung der Militärblöcke, vor allem der Nato und des Warschauer Paktes einhergehen.“
Die Klimabewegung hat in ihrem Bereich sehr Wichtiges geleistet
Gefordert wurde auch der „Abbau der deutschen Rüstungsindustrie und deren Umstellung auf friedliche Produktion, z.B. auf neue Energiesysteme und Fertigungen für den Umweltschutz.“ Zu unserem Wirtschaftssystem hieß es: „Die Großkonzerne sind in überschaubare Betriebe zu entflechten, die von den dort Arbeitenden demokratisch selbstverwaltet werden.“ Und schließlich: „Wir verurteilen die Anmaßung der Industrieländer, aufgrund wirtschaftlicher Interessen ihre technisch-materialistische Einheitszivilisation allen Menschen aufdrängen zu wollen.“
Und heute? Die neokonservative Partei mit grünem Namen, die LNG-Terminals für Frackinggas baut, das Asylrecht verschärft und wie eine Außendienststelle des Nato-Hauptquartiers agiert, hat kaum noch Schnittmengen mit dem, was sie einmal war. Aber wie steht es um die Bewegungen? Die Klimabewegung hat in ihrem Bereich sehr Wichtiges geleistet. Doch mit der neuen Friedensbewegung will sie nichts zu tun haben. (Sind das nicht alles verkappte Putinversteher?) Umgekehrt fordern viele von denen, die heute für eine Verhandlungslösung in der Ukraine eintreten, zugleich billige fossile Energien; manche sehen Klimaschutz als Bedrohung für ihr Wohlstandsmodell. Die Gräben sind tief.
Ohne ambitionierten Klima- und Biodiversitätsschutz kein Frieden und Gerechtigkeit
Dabei gehören Frieden, Ökologie, Klima und soziale Gerechtigkeit auch heute untrennbar zusammen. Die neue Blockkonfrontation mit China und Russland führt dazu, dass Hunderte Milliarden Euro zusätzlich in die destruktivste Branche der Erde fließen – das Militär – und damit für einen sozial-ökologischen Umbau fehlen. Der neue kalte Krieg blockiert außerdem dringend notwendige internationale Vereinbarungen, um fossile Energieträger im Boden zu belassen. Diplomatie und Entspannungspolitik, so schwierig sie heute auch sein mögen, sind daher unabdingbar für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen.
Umgekehrt sind ohne ambitionierten Klima- und Biodiversitätsschutz Frieden und Gerechtigkeit nicht zu haben. Wir stehen vor gefährlichen Kipppunkten im Erdsystem, ob beim Amazonas-Regenwald, den Permafrostböden Sibiriens oder den Eismassen Grönlands und der Westantarktis. Werden sie überschritten, droht die Erde in einen gänzlich neuen Zustand zu kippen, genannt „Hothouse Earth“: Teile Südasiens, des Mittleren Ostens und Afrikas könnten unbewohnbar werden. Die schon jetzt verheerenden Dürren in Europa könnten sich zu existenzbedrohenden Wassernotständen ausweiten.
Eine Aufarbeitung ist unverzichtbar
Auf sich gestellt sind alle Einzelbewegungen, ob für Klimaschutz, Frieden oder soziale Gerechtigkeit zum Scheitern verurteilt. Eine isolierte Friedensbewegung hat wenig Chancen gegen einen parteiübergreifenden neuen Bellizismus; eine Klimabewegung, die nur ihr Thema im Auge hat und keine breiten Bündnisse eingeht, wird nicht genügend Kraft und gesellschaftliche Akzeptanz gewinnen können. Die zunehmende Polarisierung und Spaltung nützt allein denen, die die gegenwärtige ruinöse Ordnung der Welt solange wie möglich aufrechterhalten wollen.
Aus diesen Gründen sind Versuche, die Gräben zu überwinden, von entscheidender Bedeutung. Das ist schwer, gewiss. Denn man müsste sich das, was die Gräben so tief gemacht hat, zunächst einmal gemeinsam anschauen. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass es eine ernsthafte Aufarbeitung der Coronazeit gibt, dass Fehlentscheidungen zugegeben und Entschuldigungen ausgesprochen werden. Es würde bedeuten, Kontaktängste zu überwinden und dort, wo der Dialog abgerissen ist, wieder miteinander zu sprechen, im informellen Austausch ebenso wie in öffentlichen Veranstaltungen.
So sehr es das eigene Ego auch bestätigen mag, in seiner Twitterblase unterwegs zu sein und Podien mit seinen politischen Freunden zu besetzen, so wenig hilft das in der gegenwärtigen Weltlage weiter. Wo sind die Veranstaltungen, wo die Fernsehsendungen, in denen eine Luisa Neubauer und eine Daniela Dahn über Kontroversen zu den Themen Ukraine und Corona sprechen? Eine Aufarbeitung ist unverzichtbar, gerade da, wo sie unbequem ist.
Die gesellschaftliche Linke war immer schon sehr gut darin, sich selbst zu zerlegen
„Allein machen sie dich ein“, sangen einst Ton Steine Scherben. Die Geschichte der sozialen Bewegungen gibt ihnen recht. Erst wenn sich Bewegungen verschiedener Milieus und Stoßrichtungen zusammenschließen, geraten die Verhältnisse ins Tanzen, wird es ungemütlich für die politischen und ökonomischen Eliten. In den 1960er- und 70er-Jahren war es das Zusammenfließen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung mit dem Widerstand gegen den Vietnamkrieg, den indigenen Bewegungen, der Frauenbewegung und schließlich der neu aufkommenden Ökologiebewegung, die das Herrschaftsgefüge der Nachkriegszeit ins Wanken brachte.
Die amerikanische Regierung war so besorgt über diese systemerschütternde Kooperation, dass sie das FBI mit umfassenden geheimen Operationen beauftragte, die die Bewegungen „diskreditieren, destabilisieren und demoralisieren“ sollten. Dieses Programm, das 1971 unter dem Namen COINTELPRO durch Leaks der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, säte den Geist der Spaltung unter anderem mithilfe von agents provocateurs, die sektiererische Positionen propagierten. Die gesellschaftliche Linke war immer schon sehr gut darin, sich selbst zu zerlegen, dazu braucht sie nicht unbedingt das FBI. Doch eines können wir aus dieser Geschichte lernen: Vor nichts haben die Statthalter des Status Quo so viel Angst wie vor einer Zusammenarbeit von Ökologie-, Friedens- und Gerechtigkeitsbewegungen. Und nichts macht ihnen das Regieren so leicht wie deren Spaltung.
Fabian Scheidler studierte Geschichte und Philosophie und arbeitet als freischaffender Autor für Printmedien, Fernsehen und Theater. 2015 erschien sein Buch „Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation“, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde, gefolgt von „Chaos. Das neue Zeitalter der Revolutionen“ (2017). 2021 erschien im Piper Verlag „Der Stoff, aus dem wir sind. Warum wir Natur und Gesellschaft neu denken müssen“. Fabian Scheidler erhielt 2009 den Otto-Brenner-Medienpreis für kritischen Journalismus. www.fabian-scheidler.de
In der Debatte um den Ukrainekrieg wird oft argumentiert, für eine Verhandlungslösung sei es noch zu früh – und mit Wladimir Putin sei eine solche vielleicht ohnehin unmöglich. Dem widerspricht der Publizist Fabian Scheidler: Angesichts der Bedrohungen durch Klimakrise und Atomkrieg sei ein Dialog mehr geboten denn je.
Die Pentagon-Leaks aus dem Frühjahr dieses Jahres haben gezeigt, dass aus Sicht des US-Militärs die Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine in eine Pattsituation geraten ist. Keine der beiden Seiten kann, so die Einschätzung, in absehbarer Zeit siegen. Das hatten bereits zuvor führende Militärs wie etwa General Mark A. Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, öffentlich gesagt.[1] Damit aber werden Verhandlungen, so schwierig sie auch sein mögen, zur einzig rationalen Handlungsoption. Denn eine Fortsetzung des Krieges unter diesen Bedingungen würde in ein schier endloses Blutvergießen münden, in ein neues Verdun, ohne dass damit das angestrebte Ziel, eine vollständige Wiederherstellung der ukrainischen Souveränität, erreicht werden würde. Zugleich würde eine nukleare Eskalation immer wahrscheinlicher.
Jede ethisch fundierte Position in einem solchen Konflikt muss zwischen den Risiken und Opfern, die für ein Ziel gebracht werden sollen, und dem, was realistisch erreicht werden kann, abwägen. Die russische Führung hat mit dem Einmarsch in die Ukraine ein schweres Verbrechen begangen, gegen die Menschen und gegen das Völkerrecht. Doch wenn die vollständige militärische Rückeroberung der besetzten Gebiete durch die Ukraine nicht realistisch ist und der Kampf darum nur enorme, letztlich sinnlose Opfer kosten wird, dann steht eine Frage im Raum: Wie viele Menschen sollen noch sterben, um den künftigen Grenzverlauf um wie viele Kilometer zu verschieben?
Doch bereits diese Frage gilt bei vielen, die sich lautstark als Freunde der Ukraine in Szene setzen, als zynisch und unsolidarisch mit den Angegriffenen. Aber ist es nicht im Gegenteil zynisch, genau diese Frage nicht zu stellen? Während Generäle, Politiker und Journalisten über Kriegsziele und Prinzipien diskutieren, sterben in der Ukraine täglich Menschen, die nie darüber abstimmen konnten, ob sie für diese Ziele ihr Leben lassen wollen, weder auf russischer noch auf ukrainischer Seite.
Das führt zu der wichtigen, von Max Weber stammenden Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Gesinnungsethik begnügt sich damit, abstrakte Prinzipien zu verteidigen, egal was die Folgen sind. Verantwortungsethik denkt vom gewünschten Ergebnis her. In unserem Fall hieße das beispielsweise: Welche Schritte muss man in der realen, oft unschönen Welt unternehmen, um möglichst viele Menschenleben zu retten, der Ukraine eine Zukunft zu ermöglichen und einen Atomkrieg zu verhindern?
Die Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr etwa gründete in vieler Hinsicht in einer Verantwortungsethik. Ihre Logik lautete: Auch wenn wir die Herrscher im Kreml missbilligen, ja selbst wenn wir meinten, sie seien die Inkarnation des Bösen, so müssen wir doch mit ihnen sprechen und sogar verhandeln. Zum einen, um konkrete Erleichterungen für die Menschen zu erreichen, zum anderen, um zu verhindern, dass wir alle in einem Atomkrieg sterben.
»Die Welt steht vor einer ganzen Reihe von gefährlichen Kipppunkten, geopolitisch wie ökologisch.«
Um das zu erreichen, sind großspurige moralische Lektionen und eine Anrufung der „westlichen Werte“ oft wenig zielführend. Sie führen zwar dazu, dass man sich selbst moralisch erhoben und auf der richtigen Seite fühlt, tragen aber nichts zu einer Entschärfung der Lage bei. Im Gegenteil: Wie bereits im Fall des Kriegs gegen den Terror nach Nine Eleven verbaut die Selbstbeweihräucherung den Blick auf die Realität und kann damit in eine Spirale der Zerstörung führen.
Die Frage nach Gesinnungs- oder Verantwortungsethik geht aber weit über die Kriegsfolgen im engeren Sinne hinaus und bezieht sich auf die gesamte globale Situation.
Die Welt steht heute vor einer ganzen Reihe von gefährlichen Kipppunkten, geopolitisch wie ökologisch. Zum einen erhöht eine dauerhafte neue Blockkonfrontation die Gefahr eines Atomkriegs erheblich. Selbst ein „begrenzter“ nuklearer Schlagabtausch würde global in einen nuklearen Winter führen und einen großen Teil der Menschheit auslöschen. Allein aus diesem Grund ist eine verantwortungsethische Diplomatie die einzig rationale Handlungsoption. Zum anderen zerstört der neue kalte und heiße Krieg gleich in mehrfacher Hinsicht die Chance, einen Klima- und Biosphärenkollaps noch zu verhindern. Überschreiten wir einige der unmittelbar bevorstehenden Kipppunkte im Klimasystem, dann droht die Erde in einen vollkommen neuen Zustand überzugehen: das Hothouse Earth. Ganze Erdregionen, darunter Teile Südasiens, des Mittleren Ostens und Afrikas, würden unbewohnbar. Um das zu verhindern, muss der größte Teil der noch in der Erdkruste befindlichen fossilen Energien im Boden verbleiben. Und dazu ist wiederum eine intensivierte internationale Kooperation – auch mit China und Russland – unerlässlich.
So abwegig das im Augenblick auch erscheint: Der Westen muss Russland Angebote machen, wie es von einem Exporteur fossiler Brennstoffe zu einem Produzenten erneuerbarer Energien werden kann – denn dafür hat das größte Land der Erde enorme Potenziale. Bleibt Russland aus westlicher Sicht ein Paria, mit dem man nicht redet, ist eine solche Perspektive undenkbar.
Die neue Blockkonfrontation droht darüber hinaus die dringend für den sozial-ökologischen Umbau benötigten Ressourcen in den destruktivsten und klimaschädlichsten aller Sektoren zu kanalisieren: ins Militär. Damit zeichnet sich eine fatale Wiederholung der Dynamik nach dem 11. September 2001 ab. Das „Cost of War“-Projekt der renommierten Brown University beziffert die Kosten des Afghanistankrieges allein für den US-Haushalt auf 2100 Mrd. US-Dollar – das entspricht unvorstellbaren 300 Mio. pro Tag, und das über 20 Jahre lang. Die Kriege in Irak und Syrien schlugen insgesamt mit 2900 Mrd. Dollar zu Buche.[2] Zum Vergleich: Das Budget, das die Entwicklungsländer seit Jahren für die Bekämpfung der ärgsten Folgen des Klimawandels fordern, beträgt 100 Mrd. Dollar – gemessen daran eine geradezu winzige Summe, die aber von den reichen Industrienationen bis heute nicht vollständig zur Verfügung gestellt wurde.
Nach den Berechnungen des US-Ökonomen Robert Pollin würde ein wirkungsvoller Global Green New Deal, der ein verheerendes Klimachaos noch verhindern könnte, etwa 4,5 Bill. Dollar jährlich kosten – etwa fünf Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.[3] Das wäre durchaus finanzierbar, allerdings nur, wenn zugleich weltweit die Militärausgaben gedrosselt werden würden. Die neue Aufrüstung auf beiden Seiten infolge des Ukrainekriegs droht daher ein weiteres Mal den Weg zu einem ernsthaften ökologischen Umbau zu blockieren. Und damit dürfte womöglich die letzte Chance zur Erhaltung des Erdsystems, wie wir es kannten, beerdigt werden.
An diesem Punkt wird auch deutlich, warum Friedens- und Klimabewegung untrennbar zusammengehören. Die enormen Anstrengungen der Klimabewegung werden vergeblich sein, wenn sie nicht mit einer realistischen friedenspolitischen Perspektive verbunden werden.
Und umgekehrt wird es keinen Frieden geben, wenn wir mit 14 000 Atomsprengköpfen und einer Milliarde Kleinwaffen, die es auf der Erde gibt, ins Klimachaos schlittern. Auf den derzeit zutiefst gespaltenen Bewegungen liegt also eine große Verantwortung, trotz aller Differenzen aufeinander zuzugehen, Brücken zu bauen und gemeinsam zu handeln.
Der so dringend erforderliche Gedanke an Abwägungsprozesse und Verhandlungsinitiativen wird oft mit zwei Argumenten beiseite gewischt: Zum einen, so heißt es, könne man mit einem Monster wie Putin nicht verhandeln. Doch die Geschichte der Verhandlungen im März 2022, die zu erheblichen Annäherungen der beiden Seiten geführt hatte, beweist das Gegenteil.[4]
»Der Ukrainekrieg wird zu einem erheblichen Teil aus geopolitischen Motiven geführt und betrifft die Überlebenschancen aller Menschen.«
Zweitens wird, insbesondere von der US-Regierung, immer wieder darauf hingewiesen, dass es uns nicht anstehe, Kompromisse vorzuschlagen; das sei ausschließlich Sache der Ukrainer. Natürlich ist es an der Ukraine und vor allem an ihren Bürgern – die allerdings seit Jahren zu all dem gar nicht mehr gefragt worden sind –, Entscheidungen über Krieg, Frieden und Verhandlungen zu treffen. Aber es ist vollkommen realitätsfremd, so zu tun, als ob dieser Krieg in einem geopolitischen Vakuum stattfände.
Die Positionen von Frankreich, Deutschland, Großbritannien und vor allem der USA haben de facto erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen der ukrainischen Regierung, ebenso wie auch die Positionen Chinas und anderer Länder des Globalen Südens Einfluss auf Moskau haben. Kiew ist finanziell und militärisch vollkommen abhängig von Washington, ohne die Hilfen des Westens würde der Staat in kürzester Zeit zusammenbrechen. In dieser Situation so zu tun, als sei die ukrainische Regierung vollkommen autark und souverän, ist absurd.Es ist auch interessant, dass das Argument gegen Einmischung ausgerechnet von den USA kommt, die sich seit langem permanent in die Angelegenheiten der Ukraine eingemischt haben, und zwar massiv. Anfang Februar 2014, als der Maidanaufstand, der später zum Sturz der Regierung Janukowitsch führte, in vollem Gange war, tauchte das Leak eines Telefongesprächs zwischen Victoria Nuland, damals US-Chefdiplomatin für die EU, und Geoffrey Pyatt, dem US-Botschafter in Kiew, auf. Das Telefonat wurde berühmt durch Nulands Ausspruch „Fuck the EU“. Weniger bekannt, aber noch wichtiger ist die Art und Weise, wie Nuland und Pyatt darüber berieten, wie die künftige Regierung der Ukraine aussehen soll. Hier ein Auszug:
„Nuland: Ich denke, Klitsch sollte nicht in die Regierung gehen. Ich denke, es ist nicht nötig, es ist keine gute Idee.
Pyatt: Ja, ich meine, man sollte ihn lieber draußen lassen und seine politischen Hausaufgaben machen lassen. Ich denke, was den voranschreitenden Prozess angeht, wollen wir die moderaten Demokraten zusammenhalten. Das Problem werden Tjagnibok und seine Leute sein. [Oleg Tjagnibok war Vorsitzender der rechtsextremen, antisemitischen Swoboda-Partei, d. Verf.] […]
Nuland: Ich denke, Jats ist der Mann, der die wirtschaftliche Erfahrung hat, die Regierungserfahrung. Er ist der Mann. Was er braucht, sind Klitsch und Tjagnibok draußen. Er sollte mit ihnen vier Mal die Woche sprechen.“[5]
„Jats“ (gemeint ist Arsenij Jatsenuk) und „Klitsch“ (Vitali Klitschko): Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Nuland und Pyatt die zu diesem Zeitpunkt wichtigsten Oppositionspolitiker im Wesentlichen als Marionetten betrachteten, die man am grünen Tisch in Washington herumschieben kann. Tatsächlich wurde Nulands Wunsch, dass „Jats“ Ministerpräsident der Ukraine werden sollte, am 27. Februar 2014 Wirklichkeit. Sieht so der Umgang mit einem souveränen Land aus, das gänzlich unabhängige Entscheidungen trifft?
Nein, der Ukrainekrieg ist ein globaler Konflikt, er wird zu einem erheblichen Teil aus geopolitischen Motiven geführt und er betrifft die Überlebenschancen aller Menschen. Der Westen muss daher endlich seinen Einfluss nutzen, um etwas zu seiner Beendigung beizutragen, statt Verhandlungsoptionen mit fadenscheinigen Argumenten beiseite zu wischen – auch wenn das nach den bisherigen Verwüstungen und der Zerstörung des Kachowka-Staudamms schwieriger denn je ist. Brasilien, China und Südafrika haben neue Friedensinitiativen auf den Weg gebracht. Die westlichen Länder sollten sich ihnen anschließen.
[1] Vgl. Peter Baker, Top U.S. General Urges Diplomacy in Ukraine While Biden Advisers Resist, www.nytimes.com, 10.11.2022.
[2] Vgl. Costs of War, https://watson.brown.edu.
[3] Vgl. Noam Chomsky und Robert Pollin, Die Klimakrise und der Green New Deal, Münster 2021.
[4] Vgl. Fabian Scheidler, Naftali Bennett wollte den Frieden zwischen Ukraine und Russland: Wer hat blockiert?, www.berliner-zeitung.de, 6.2.2023.
[5] Ukraine crisis: Transcript of leaked Nuland-Pyatt call, www.bbc.com, 7.2.2014.
Seite 5 von 17